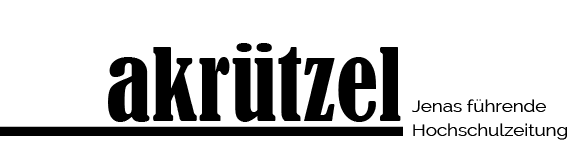Bärbel Kracke ist neben ihrer Professur der Pädagogischen Psychologie als Gleichstellungsbeauftragte tätig. Ein Gespräch über Repräsentation, Vorurteile und Übergriffigkeit.
Das Gespräch führten Nora Haselmayer und Carolin Lehmann
Wie würden Sie Ihre Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte (GSB) definieren?
Das unterrepräsentierte Geschlecht soll gefördert werden, um diese Diskrepanz langfristig zu überwinden. Aktuell sind an der FSU 53,8 Prozent der Studierenden Frauen, aber nur 36 Prozent der Habilitationen zwischen 2016 und 2018 wurden von Frauen vorgelegt. Die GSB sitzen in vielen Gremien und überprüfen Prozesse: Wie läuft die Stipendienvergabe für Promotionen? Geht es in irgendeiner Weise Frauen gegenüber unfair zu? Wurden in einem Berufungsverfahren vielleicht die Erziehungszeiten einer Frau nicht beachtet? Oder wir machen auf den Gender Bias aufmerksam: Wenn das generische Maskulinum benutzt wird, fühlen sich Frauen oft nicht mitgemeint. Wenn die ganze Zeit davon geredet wird, dass „der Wissenschaftler herausfand“ und „ein Politiker meinte“, assoziieren Menschen eher Männer und vergessen, dass die Gesellschaft auch durch weibliche Geschicke gelenkt wird. Als GSB schauen wir, wie die Texte der Uni gestaltet sind. Gibt es unfaire Sprache in Lehrveranstaltungen? Werden etwa sehr geschlechtstypische Beispiele genutzt? Wenn in Fallbeispielen immer die zuarbeitende Person eine Frau und der Chef ein Mann ist, wird damit das Klische „die Sekretärin, der Chef“ transportiert.

Es geht um Details?
Total! Über die grundsätzliche Gleichheit der Geschlechter sind sich ja alle Menschen einig, die steht im Grundgesetz. Die Realität sieht anders aus. Man muss Frauen erstmal die Chance geben, sich in Führungspositionen zu bewähren. Schließlich bringen auch viele Männer in hohen Jobs keine Topleistungen. Bei Frauen wird aber häufig viel kritischer hingeschaut – dazu gibt es unzählige Studien. Frauen werden in Arbeitszeugnissen oder in Begutachtungen mit Worten beschrieben, die in Richtung Fleiß gehen, während Männer „hervorragend“ und „kreativ“ sind. Die GSB ist auch in Berufungsverfahren eingebunden. Es gibt zwei zentrale GSB, Frau Prof. Hildebrandt und mich, und an jeder Fakultät dezentrale Beauftragte. Auch diese achten in Berufungsverfahren auf stereotype Argumentationen oder unsachliche Unterstellungen gegenüber Frauen. Diese Gleichstellungsarbeit wird im GS-Büro koordiniert. Alle GSB werden alle drei Jahre neu gewählt.
Gibt es Vorurteile gegenüber Ihrer Position als GSB, die Sie gern entkräften würden?
Dass es darum gehe, die Position von Frauen um jeden Preis zu stärken. Dass es gar nicht um Leistung gehe, sondern um das Prinzip: Hauptsache, Frauen werden befördert. Oder dass es einen derartigen Fokus auf die Geschlechtergleichstellung gibt, dass andere gesellschaftliche Probleme vergessen werden: Fragen der Intersektionalität. Mir ist bewusst, dass Armut ein großes Problem ist. Auch, dass Menschen mit nicht-akademischen Elternhäusern schlechtere Chancen auf eine Karriere in der Wissenschaft haben. Aber die grundsätzliche Unterrepräsentanz von Frauen in den wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen muss auch gelöst werden. Seit 2019 hat die Uni Jena auch einen Diversity-Beauftragten für die anderen Diversitätsdimensionen. Wir arbeiten eng zusammen und an manchen Stellen treffen sich unsere Jobs.
Da geht es um LGBTQ und non-binäre Menschen?
Genau. Und um Studierende und Mitarbeiter:innen aus anderen Kulturen sowie mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Für wie weit halten Sie denn die Uni, was die Gleichstellung anbelangt?
Wenn man rein auf die Daten schaut, haben wir keine Gleichstellung. In der Professor:innenschaft in Jena sind es 24,7 Prozent Frauen und auf allen anderen Ebenen werden es auch bei jedem Karriereschritt weniger Frauen. Das nennt man „Leaky Pipeline“. Das ist repräsentativ für Deutschland. Selbst in Fächern, in denen viele Frauen studieren, zum Beispiel Psychologie, sind trotzdem mehr Professuren von Männern besetzt als von Frauen. Aber in den letzten Jahren haben sich die Prozesse zur Absicherung der Geschlechtergerechtigkeit in den Verfahren deutlich verbessert.
Gibt es etwas Bestimmtes, woran es fehlt, um Gleichstellung zu verwirklichen?
Es braucht viel Ermutigung für Frauen an der Uni, schon ganz früh, schon im Studium, den Blick freizumachen und zu sagen: „Ich kann Professorin werden oder Wissenschaftlerin. Ich übernehme Verantwortung für meine Fragestellung, traue mich, das zu vertreten und vorzustellen, bemühe mich um einen Hilfskraftjob, ein Stipendium.“ Ein großes Problem an der Uni sind die Befristungen in der Postdoc-Phase, in der die meisten Frauen verloren gehen. Zur Familiengründung ist irgendwann Sicherheit notwendig. Da stellt sich die Frage: Wie kann man Positionen schaffen, die wissenschaftliche Produktivität mit Sicherheit verbinden? Das könnte man zum Beispiel durch mehr Jobs im Mittelbau schaffen, auf denen man sich ohne eng getakteten Befristungsdruck, aber mit Zielvereinbarungen weiter qualifizieren kann und gerade Frauen sich dann in Ruhe auf Professor:innenstellen bewerben können.
Mit welchen Anliegen können sich Studierende an Sie wenden?
ben: Da ist etwas, das mich behindert, und mein Geschlecht steht im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn ein männlicher Dozent in Lehrsituationen Frauen vermittelt, er achte auf ihr Äußeres, sodass sie sich dann nicht mehr ungehemmt bewegen können. Oder ein Dozent äußert gegenüber einer Studentin, dass er sie gerne mal privat treffen würde. Die Studentin kann dann nicht mehr ungehemmt die Lehrveranstaltung besuchen, obwohl es vielleicht interessant wäre, weil sie denkt: Der will mehr von mir. Dann kommen auch Frauen in der Doktorandenphase zu uns, die Sprüche über ihr Äußeres zu hören bekommen, übergriffig umarmt werden oder immer bestimmte Jobs, zum Beispiel in der Laborarbeit, zugeteilt bekommen, die von männlichen Kollegen nie erwartet werden.
Gab es eine Situation, die Sie in Ihrem Amt erlebt haben, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, gibt es. Aber die kann ich Ihnen nicht erzählen. Es gibt frustrierende Vorkommnisse: Wenn sich Probleme zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen nicht lösen lassen. Die in der Kündigung der Frau resultieren. Das ist bitter für die Frau, die ihr Potenzial nicht weiter entfalten kann. Die Hoffnung ist dann, dass der Vorgesetzte nicht nachtritt und der Person so noch mehr schadet. Es ist besonders bedrückend, wenn es in einer bestimmten Arbeitsgruppe häufiger zu Abbrüchen von Frauen kommt, weil ein meist männlicher Chef keine gute Frauenförderung betreibt, sondern die Frauen durch sein Gebaren zum Aufgeben bringt. Es ist schwer für die GSB, da einzugreifen, weil die betroffenen Frauen beispielsweise bei einer sexuellen Belästigung oder Diskriminierung klar Namen nennen müssten: Der Mann XY hat das und das gemacht. Erst dann kann man auf den Vorgesetzten zugehen. Viele Frauen sind nicht bereit, diese Konfrontation einzugehen.
Gibt es etwas, was Sie jungen Frauen gerne mit auf den Weg geben würden?
Junge Frauen sollten sich in keinster Weise behindern lassen durch Fragen wie: Wie wirke ich? Wie sehe ich aus? Oder: Was denken andere über mich? Das ist ein häufiger Fokus, der gerade junge Frauen noch immer behindert, voll aufzudrehen und aufzutreten. Es ist gut, sich solcher Barrieren bewusst zu werden und zu sagen: „Ich brauch das nicht.“ Ganz wichtig ist auch, sich zusammenzuschließen, statt Einzelkämpferin zu sein. Und sich zu trauen. Auch wenn irgendjemand erstmal nicht von der Idee begeistert ist, sollten sie trotzdem dranbleiben und jemanden finden, der die Idee unterstützt und sie dann durchsetzen. Wirkt das platt auf Sie, wenn ich das so sage?
Finden wir überhaupt nicht. Das kann man nicht oft genug sagen.
Einen Punkt finde ich auch noch wichtig: Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann nervt man eben Leute. Das muss man einfach ertragen. Irgendwann trifft man auf jemanden, der sagt: „Wow, super!“ Dieses Nervenkönnen, das ist echt wichtig. Das sieht man auch an bestimmten Politikerinnen, die ich toll finde. Die sind zum Teil total penetrant und bekommen oft eine Schelte: „Die immer mit ihrem gleichen Punkt.“ Frauen in meiner Generation sind oft die einzigen Frauen in einem männlichen Kollegium. Man sagt etwas – zum Beispiel betreffend Studierender oder der Interaktionsformen am Institut – und bekommt die Antwort: „Du bist halt so eine Kümmerin.“ Dann denke ich: Ja gut, Kümmerin ist super. Denn was ist, wenn man sich nicht kümmert?
Möchten Sie noch irgendetwas anmerken?
Es sollte in der Sprache berücksichtigt werden, dass es auch Menschen gibt, die sich als nicht binär ansehen. Das ist ein Kennzeichen einer toleranten, veränderungsbereiten Gesellschaft. Gerade Universitäten sollten hier Vorreiter sein. Ich bin der Auffassung, dass es wichtig ist, mit der fortgeschrittenen Sprache konstruktiv umzugehen, obwohl wir gar nicht wissen, ob das in zehn oder in zwanzig Jahren immer noch so wichtig ist. Der Mehrheit der Studienanfänger:innen ist es aber wichtig, dass da so eine Sprachsensibilität existiert, während es der Mehrheit der Über- 50-Jährigen in der Bevölkerung nicht so wichtig zu sein scheint. Zu diesen Themen muss sich die Uni auch positionieren: Wollen wir ein Ort sein, an dem die junge Generation sich angemessen vertreten fühlt?