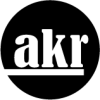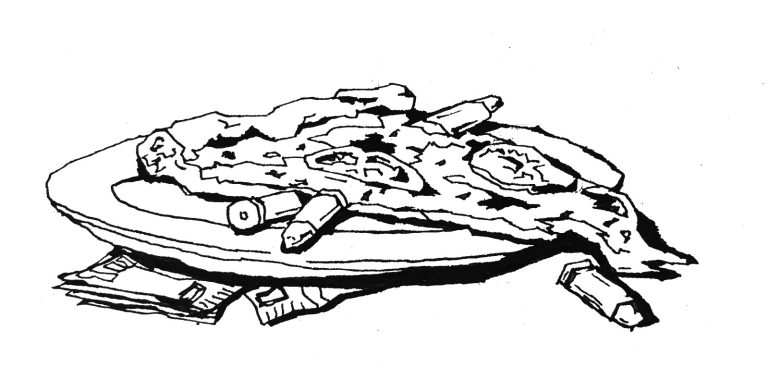Drogen, Immobilien und ganz viel Geld: Die kalabrische Mafia ’Ndrangheta ist auch in Thüringen.
Der grauhaarige Pate sitzt mit Rose am Revers im Halbdunkel und sagt: „Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.“ Ein attraktiver Italiener ent- und verführt mit Hilfe von schnellen Autos und Riesenvillen eine junge Frau. So oder so ähnlich stellt man sich die Mafia vor. Doch dieses Bild der Mafia ist glorifizierend.
Deutschland, Thüringen und die Mafia
Mit der Realität der Mafia setzte sich ein Untersuchungsausschuss (UA) im Thüringer Landtag zwischen 2021 und 2024 auseinander, eingesetzt durch die Fraktionen der Linken, SPD und Grünen. Anlass war eine Recherche vom MDR und der FAZ zu einem bundesdeutschen Ermittlungsverfahren gegen die italienische Mafia Anfang der 2000er Jahre. Doch was macht diese eigentlich in Thüringen und Deutschland?
Seit den 1970er Jahren expandiert die italienische Mafia nach Deutschland. Genauer gesagt war es die ’Ndrangheta, eine Mafiaorganisation aus Kalabrien in Süditalien, die Deutschland als Ort der Investitionen, Geldwäsche und des Drogenhandels für sich entdeckte. Nach der Wende sieht die ’Ndrangheta in Ostdeutschland eine infrastrukturell schwache Region, die aber reich an günstigen Immobilien ist. Es werden zahlreiche Räumlichkeiten und Gebäude gekauft, Restaurants eröffnet und damit Möglichkeiten zur Geldwäsche eingerichtet.
So auch in Erfurt: Matteo Marino* und Alfredo Ricci* eröffnen Anfang der 1990er Jahre gemeinsam zwei Restaurants. Bald sind das Rossini, vor allem aber das Paganini beliebte Adressen der Erfurter:innen. In Letzterem stehen sich 1996 plötzlich nordrhein-westfälische Ermittler:innen und thüringische LKA-Beamt:innen gegenüber: Die einen durchsuchen das Restaurant im Zusammenhang mit einem Mordfall, die anderen schützen den damaligen Ministerpräsidenten Thüringens Bernhard Vogel (CDU) und seinen Innenminister Richard Dewes (SPD), die außerhalb der Öffnungszeiten gemeinsam dinieren.
Ricci war mit Innenminister Dewes bekannt – die Erfurter Stadtgesellschaft und ihre politischen Vertreter:innen schätzten den Wohltäter. Ein Glück, denn zum einen profitierte so die ’Ndrangheta von Ricci, der ihr öffentliches Gesicht verkörperte, Kontakte knüpfte, Geschäfte und den Umgang mit Behörden abwickelte. Zum anderen blendete dieser Schein die Öffentlichkeit und lenkte von den Vorgängen hinter den Kulissen ab: Ricci war vorbestraft und auch in Erfurt in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Die Vorstrafen stammten noch aus seiner Zeit in Duisburg, wo er wegen Drogenhandels verurteilt wurde.
Ricci und Marino werden der sogenannten Erfurter Gruppe zugerechnet. Einige der mutmaßlich sechsköpfigen Gruppe eröffnen zwischen 1996 und 2006 mindestens sieben Lokale und Unternehmen in Erfurt, pflegen dort Kontakte in Politik und Justiz und expandieren unter anderem nach Leipzig, Dresden, Kassel und schließlich bis nach Rom und Lissabon. Das gesamte Investitionsvolumen: 100 Millionen Euro.
Dass Ricci es war, der diese Kontakte pflegte, kam ihm auch persönlich zugute: 2001 erhebt die Staatsanwaltschaft Gera Anklage gegen ihn. Der Vorwurf: Drogenhandel. Kurzerhand bittet Ricci seinen häufigen Gast und Freund, den Richter Schmidt* am Erfurter Amtsgericht, um Hilfe. Die beiden treffen sich im Paganini und Schmidt hilft tatsächlich: Er ruft prompt den CDU-nahen Rechtsanwalt Hans-Peter Müller* an, erklärt den Sachverhalt und vermittelt die rechtliche Unterstützung. Keiner der drei weiß offenbar, dass das Handy des mutmaßlichen Mafiosi, von dem ausSchmidt Müller anruft, von der Polizei abgehört wird.
2007 gerät die ’Ndrangheta erstmals in die bundesdeutsche Öffentlichkeit: In Duisburg kommt es vor dem italienischen Restaurant Da Bruno zu einer Schießerei, bei der sechs Menschen getötet werden. Eine Fehde zweier Mafia-Familien eskaliert – mitten in Deutschland. Der Besitzer: Matteo Marino, der das Restaurant 1993 von Alfredo Ricci erwirbt.
Der Sechsfachmord führt zu einem Umdenken in den Entscheidungsgremien der ’Ndrangheta: Um ähnliche Ereignisse in Deutschland zu vermeiden, wird ein Crimine di Germania gegründet. Als Aufsichtsgremium existiert diese Organisationseinheit der ’Ndrangheta nur in Italien und Deutschland – ein Hinweis auf die Bedeutung Deutschlands für die kalabrische Mafia. Als Crimine werden regelmäßige Treffen der Führungsspitze der ’Ndrangheta bezeichnet, in der beispielsweise Streitigkeiten zwischen den einzelnen ’Ndrangheta-Familien zu schlichten versucht werden.
Gewaltbereit seit 200 Jahren
Die Geschichte der italienischen Mafia ist eine Geschichte der Gewalt: Im 19. Jahrhundert formieren sich im armen Süditalien konspirative Familienclans fernab einer zentralen Staatsgewalt. Statt der staatlichen Autorität sind es also mafiöse Vereinigungen, die das gesellschaftliche Miteinander organisieren, (gewaltsam) für Stabilität sorgen und damit Rückhalt in der Gesellschaft erzwingen. Die Mafia ist deshalb alles andere als ein „Fremdkörper“, schreibt die Journalistin und Mafia-Expertin Petra Reski. Die Mafia „arbeitet im sozialen und politischen Herzen einer Gesellschaft“.
Dieser Rückhalt bricht auch nicht ein, als die ’Ndrangheta in den 1970er und 80er Jahren Mitglieder reicher Familien entführt, um Lösegelder zu erpressen. Mit den Geldern finanziert sich die ’Ndrangheta ihren Auf- und Einstieg ins Drogengeschäft.
Wesentlich brutaler agiert damals die Cosa Nostra aus Sizilien: 1978 sprengt sie den Anti-Mafia-Aktivisten, Journalisten und Politiker Peppino Impastato auf Bahngleisen in die Luft. Zu oft hatte Impastato gegen die Mafia protestiert, zu oft hatte er sie lächerlich gemacht – zum Beispiel mit seiner Parole „Die Mafia ist ein Haufen Scheiße!“.
Ende der 1980er Jahre regen die Ermittlungen des Untersuchungsrichters Giovanni Falcone den sogenannten Maxi-Prozess an: verurteilt werden über 340 Mafiosi. Zum Feind der Cosa Nostra geworden, wird Falcone 1992 gemeinsam mit seiner Frau auf einer Autobahn gesprengt. Falcones Freund und Nachfolger, der Richter Paolo Borsellino, ist sich der Gefahr wohl bewusst, in der er sich nach Amtsantritt bewegt: „Ich weiß, der Sprengstoff für mich ist angekommen.“ Nur wenige Monate nach Falcone wird auch er ermordet.
Der Tod Falcones und Borsellinos erschüttert die italienische Zivilgesellschaft und erhöht den Druck auf Politik und Ermittlungsbehörden.
Amoralischer Familialismus
Es könnte der Eindruck entstehen, bei der Mafia handele es sich um irrationale Gewalttäter. Doch tatsächlich folgen alle Mafiaorganisationen strengen Regeln und damit ihrer eigenen Rationalität. Von jahrzehntelanger Blutrache bis hin zur Omertà, der absoluten Verschwiegenheit der Mafiosi, bedeutet Mafia auch ein enges Korsett aus Werten und Normen. Diese verleihen den Mafiosi das Selbstverständnis als rechtschaffene Pragmatiker und schützen die Organisation durch den anerzogenen Ehrenkodex, die Familie nicht zu verraten.
Der Verstoß gegen diesen amoralischen Familialismus wird mit dem Tod bestraft: Beispielsweise wird Maria Concetta „Cetta“ Cacciola, geboren 1980, als 13 Jährige zwangsverheiratet und Opfer häuslicher Gewalt. Sie flieht durch ein kalabrisches Zeugenschutzprogramm, nimmt jedoch erneut Kontakt zu ihrer Mutter auf, um ihre in den Händen der ’Ndrangheta zurückgelassenen Kinder wiederzusehen. Aber ihre Rückkehr zur Familie ist eine Sackgasse: Sie wird gezwungen, Salzsäure zu trinken. Das Motiv ist klar: die Ehre der gedemütigten Mafia-Familie wiederherstellen und andere pentiti, d. h. Mitglieder, die mit Polizei und Justiz kooperieren, einschüchtern.
Mutige Kooperation
Trotz dieser und ähnlicher Grausamkeiten wenden sich immer wieder pentiti an Ermittlungsbehörden. So berichtete Giuseppina „Giusy“ Pesce Freundin „Cettas“ von den Machenschaften ihres Clans. Durch ihre Hilfe konnten mehr als 40 Mitglieder der Pesce-Familie festgenommen werden.
Kronzeug:innen wie Pesce spielen in den Ermittlungen gegen die ’Ndrangheta eine entscheidende Rolle. Beispielsweise im November 2023, als mit ihrer Hilfe mehr als 300 ’Ndranghetisti verurteilt werden. Vorangetrieben wurde dieser Mammutprozess durch den Staatsanwalt Nicola Gratteri, Quasi-Nachfolger Falcones und Borsellinos und Gesicht des italienischen Anti-Mafia-Kampfes.
Wie die ’Ndrangheta gehen auch die Ermittler:innen international koordiniert vor: Im Jahr 2019 beginnt z. B. das Eureka-Verfahren, das zur bis dahin größten Anti-Mafia-Unternehmung der Welt werden soll. Vier Jahre später werden in sechs Ländern über 150 Personen festgenommen. Das Verfahren ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Zuletzt erzählte ein Kronzeuge von millionenschweren Investitionen in Restaurants aus Drogengeldern: in Erfurt.
Bereits im Jahr 2000 ermittelt das BKA gegen mehrere Italiener in Erfurt und Thüringen unter der Bezeichnung „FIDO“, zu deutsch „Vertrauen“. Darunter: Alfredo Ricci, Matteo Marino (1963) und dessen gleichnamiger Cousin und Schwager Matteo Marino (1960). Der „63er“ war es, der mit Ricci Restaurants in Erfurt eröffnete und zum Capo locale, dem örtlichen Clanboss, aufstieg. Der Verdacht gegen die drei lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da der Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft zufolge zu schwach begründet sei, werden Strukturermittlungen initiiert, um einen Überblick über Personen, Immobilien und Abläufe zu erhalten. Ein Jahr später, im Januar 2001, beginnt die Polizei mit der Überwachung der Telekommunikation (TKÜ). Dabei werden die Beamt:innen von der Offenheit, mit der die Abgehörten miteinander sprechen, überrascht: „So etwas“ wie das erwähnte Telefonat zwischen Amtsrichter Schmidt und Rechtsanwalt Müller über das Handy Riccis habe man noch nicht gehört.
Das FIDO-Verfahren zeigt aber auch, dass die Mafia weit mehr ist als Drogenhandel und Geldwäsche: „Wenn wir nur Gastronomen sein wollten, würde ein kleines Restaurant mit zehn Tischen ausreichen. Wir sind Investoren.“, sagt ein abgehörter Mafiosi.
Der ’Ndrangheta ist es gelungen, ihr Geschäft der finanzmarktkapitalistischen Gegenwart anzupassen – so Petra Reskis Urteil.
Den deutschen Ermittler:innen ist bewusst, dass sie die Unterstützung der erfahrenen italienischen Behörden brauchen. Doch diese Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig: Sogenannte Joint Investigation Teams, also Gruppen aus Ermittler:innen unterschiedlicher Staaten gibt es Anfang der 2000er noch nicht.
Stattdessen muss Rechtshilfegesuch um Rechtshilfegesuch gestellt werden, um die instabile Verbindung zwischen deutschen und italienischen Ermittler:innen aufrechtzuerhalten. Und auch innerhalb der deutschen Behörden bestehen scheinbar Probleme, erinnern sich damals beteiligte Ermittler:innen: Zwar arbeiten BKA und Thüringer LKA zusammen, jedoch unter Vorbehalt. Das BKA fürchtet, dass LKA-Polizist:innen wissentlich oder unwissentlich relevante Informationen weitergeben – schließlich gingen „auch Polizeibeamte gern italienisch essen“. Das BKA stellt das LKA deshalb als bloßen „Zuarbeiter“ab.
Erschwerte Ermittlungen
Währenddessen ist das LKA offenbar froh, Unterstützung zu erhalten, denn im Hinblick auf organisierte Kriminalität (OK) sei das LKA „eher ein bisschen provinziell“. Gleichzeitig bremst das BKA die scheinbar überdurchschnittlich motivierten LKA-Beamt:innen immer wieder aus und drängt die Behörde aus den laufenden Ermittlungen heraus: Ab einem gewissen Zeitpunkt habe das BKA aufgehört, dem LKA Informationen weiterzugeben.
Schließlich gestalten sich auch operative Maßnahmen zäh: Die Übersetzung, Aus- und Bewertung der umfangreichen TKÜ dauert zu lang, sodass keine direkten Folgemaßnahmen ergriffen werden können.
Was das FIDO-Verfahren trotz dieser Schwierigkeiten leistet, ist der Einsatz verdeckter Ermittler:innen (VE) in den Reihen der ’Ndrangheta. Sogar nach San Luca, dem Herkunftsdorf und koordinativen Herzen der ’Ndrangheta, wird ein VE eingeladen.
Aber die Einladung wird ausgeschlagen: Zu hoch sei die Gefahr für den Ermittler, aufzufliegen. Außerdem stehen die Beamt:innen vor dem Problem, wie mit den deutschen VEs in Italien, d. h. in einer völlig anderen Rechtssituation, umzugehen ist. Die VEs werden zurückgezogen und sogar TKÜ-Maßnahmen beendet – „bedauerlich“, befindet die MDR-Journalistin Margherita Bettoni angesichts des prinzipiellen Erfolgs, so nah an der ’Ndrangheta gewesen zu sein.
2006 wird dann das Verfahren ganz eingestellt, ohne eine einzige Anklage. Und ohne sachlichen Grund, wie ein ranghoher Ermittler heute konstatiert. Der damals zuständige Staatsanwalt argumentiert jedoch, die Beweislage sei unzureichend gewesen, wodurch Anklagen unmöglich und die Fortführung der Ermittlungen schwer zu rechtfertigen gewesen seien.
Aufklärung in Sicht?
Diesen Widerspruch aufzulösen, versuchte der eingangs erwähnte UA im Thüringer Landtag. Im Laufe des Ausschusses wurden zahllose Zeug:innen und Sachverständige befragt sowie Akten gesichtet.
So wurde beispielsweise die Manipulation von Kassen gastronomischer Betriebe publik: Ein Suhler Unternehmen half einem Mafiosi aus dem Dunstkreis Riccis bei der Fälschung von Betriebseinnahmen. Die Steuerhinterziehung habe die Entfaltung der ’Ndrangheta in Thüringen und Deutschland begünstigt – so der Abschlussbericht des UA. Ein Mitarbeiter des Unternehmens, befreundet mit Ricci, berichtete im Ausschuss von dessen Restaurants in Bayern, Baden-Baden, Weimar – und Jena. Im Bericht kommt auch ein im Jahr 2000 vernommener Zeuge zu Wort, der von einem „Eiscafé in Jena“ spricht, betrieben von Francesco Bianchi*. Der wiederum habe in seinen Lokalen Osteuropäer:innen illegal arbeiten lassen – gehöre aber mutmaßlich nicht zur ’Ndrangheta, so Henfling. Ob das Café heute noch Bianchi gehört, ist unklar.
Und das Ende des FIDO-Verfahrens? Der UA kommt in seinem Abschlussbericht nicht über die bloße Darstellung der widersprüchlichen Antworten zu der Frage hinaus. Eine Bewertung der UA-Ergebnisse bleibt aus. Während die CDU der Linken vorwirft, den Abschluss des Berichts verschleppt und „undiszipliniert“ gearbeitet zu haben, entgegnet diese, die CDU habe die Veröffentlichung weiterer rund 100 Seiten untersagt, die unter anderem weitere Details zum Telefonat zwischen Amtsrichter Schmidt und CDU-Anwalt Müller umfassen sollten.
Fest steht: Der Abschlussbericht erschien Monate später als geplant. Linke, SPD und Grüne geben die Schuld dafür Behörden, die immer wieder Akten vorenthielten, nachträglich als geheim einstuften und so die Arbeit des UA behinderten.
Wie geht es nun weiter? CDU und AfD sehen auf unsere Anfrage hin keine Notwendigkeit für weitere Klärung – alle Fragen seien „ausermittelt“ bzw. ihre Relevanz sowieso „äußerst gering“. Dass ausgerechnet die CDU im UA „sich kaum an der Arbeit des Ausschusses beteiligt[e]“, so Katharina König-Preuss (Linke), erweckt den Eindruck, lieber Gras über vergangene personelle Verbindungen zur ‘Ndrangheta wachsen lassen zu wollen – entgegen ihrer Selbstdarstellung als „Partei der inneren Sicherheit und eines konsequenten Rechtsstaates“.
Die Mafia macht
ihr Ding
König-Preuss (Linke) und Madeleine Henfling (Grüne) hingegen fordern im Gespräch mit dem Akrützel einen Ausschuss auf Bundes- und EU-Ebene, härtere Strafen für Geldwäschedelikte und die Kriminalisierung der Mafia-Mitgliedschaft nach italienischem Vorbild. Die SPD-Fraktion nahm auf Anfrage des Akrützel keine Stellung zur Einschätzung des UA.
Und die ’Ndrangheta? Sie wird weitermachen: Drogen verkaufen, Drogengelder waschen sowie sich in der deutschen Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik festsetzen. Der staatliche Kampf gegen die organisierte Kriminalität als solche kann nicht gewonnen werden. Wohl aber der gegen die Mafia: Von der Kriminalisierung der Mafia-Mitgliedschaft bis hin zur Sozialisierung beschlagnahmter Immobilien sind viele Maßnahmen aussichtsreich. Es bedarf aber auch einer aufgeklärten Zivilgesellschaft, die sich der Existenz und dem Vorgehen der OK bewusst ist und die weiß: Die Mafia ist vieles – nur nicht wie im Film.
Ulrike Reimer
und Thorsten Schlicke
*Namen von der Redaktion geändert