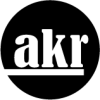Cannabis ist seit dem 1. April straffrei: Social Clubs wollen eine neue Kiffkultur
aus dem Schatten der Kriminalität heben. Aber was ändert sich wirklich?
von Götz Wagner und Catalin Dörrmann

In einem schäbigen Hinterhof eines Gewerbegebietes einer sehr schönen thüringischen Kleinstadt steht eine kleine Lagerhalle. Das Garagentor steht offen, die hohen Wände sind kalkweiß gestrichen. Die Halle ist leer, bis auf das laute Getöse eines Bautrockners, eines fahrbaren Gerüstes und einer Reihe schwerer Werkzeuge. Dass in dieser Halle eine Hightech-Grow-Anlage für einen Cannabis-Social-Club (CSC) entsteht, kann man sich nur schwer vorstellen.
Vor der Halle stehen die Gründer des CSC Erfurt, Dennis Gottschalk und Hermann Klett. Einer raucht – kein Gras. „Hier sollen mal zehn Anbauräume à elf Quadratmeter rein, jeder mit 25 Kilo Ertrag Cannabis pro Ernte.“
In ganz Deutschland haben sich Vereine gegründet, die ab dem 1. Juli eine Anbauvereinigung werden wollen. Man kann von einem Ansturm sprechen. So auch beim CSC Erfurt: Mehr als 400 Leute hätten sich schon Monate vor der ersten Ernte bei ihnen gemeldet, so Klett. Pro Club sind eigentlich nur 500 Mitglieder erlaubt. Der größte Dachverband Deutschlands, CSC Mariana, auch vertreten in Jena, hat mit allen Ortsgruppen insgesamt über 17.000 Mitglieder. Einige Ortsgruppen hätten sogar ellenlange Wartelisten.
Das zeigt: Kiffen ist nicht mehr ein Nischenthema einer kleinen Minderheit. 18 Millionen, rund ein Fünftel aller Einwohner:innen Deutschlands hätten im Leben bereits Erfahrungen mit der Droge gemacht, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Und seit Jahren steigt die Zahl der Menschen, die angeben, sie hätten in den letzten 12 Monaten mindestens einmal gekifft – im Jahr 2000 waren es nur 6 Prozent aller Erwachsenen, 2021 10 Prozent. Das sind etwa 4,5 Millionen Menschen. Tendenz: steigend.
Die Cannabis-Legalisierung erfolgte in zwei Schritten: zuerst die Legalisierung von Besitz und Eigenanbau für den Privatgebrauch im April. Ab Juli kommen dann die Anbauvereinigungen.
Doch zurück zum 1. April: Cannabis wurde von der verbotenen Liste des Betäubungsmittelgesetzes gestrichen und hat ein eigenes Gesetz bekommen, das CanG. Und auch dieses Gesetz verbietet Besitz und Anbau. Beides ist nur in einem bestimmten gesetzlichen Rahmen straffrei: eine Teillegalisierung. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen drei lebende Pflanzen, 25 Gramm auf der Straße und zuhause insgesamt 50 Gramm besitzen. Alles, was diese Menge übersteigt, ist „unverzüglich und vollständig zu vernichten“, wie es das Gesundheitsministerium treffend formuliert.
Kiffen bleibt in der Öffentlichkeit auf den ersten Blick verboten: in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr, in Schulen, auf Spielplätzen, Sportplätzen und deren Sichtweite, vom Eingangsbereich aus. Zwischen diesen Orten entsteht in Jena ein übergreifendes Netz von Verbotszonen, das sich über weite Teile der Stadt erstreckt.
Diese Art Konsumverbot hat eine naheliegende Krux: Was hat es mit dem Mysterium der Sichtweite genau auf sich? Das CanG legt zwar eine Obergrenze von 100 Meter fest, ab der etwas nicht mehr als in Sichtweite gilt. Das Gesetz lässt die Unterschreitung dieser Grenze aber offen. Ein Beispiel: Wie soll ein Kiffer dann unter dieser Grenze ohne Risiko feststellen, ob sich die Schule im Paradiespark hinter Gestrüpp und Bäumen in Sichtweite befindet oder nicht?
Entscheidend ist wohl, dass Kinder und Jugendliche den Konsum auf keine Weise wahrnehmen können. Denn der Konsum in unmittelbarer Anwesenheit Minderjähriger ist ebenfalls streng verboten. Wer sich also auf der ganz sicheren Seite bewegen will, wird effektiv aus der Innenstadt verdrängt. Das CanG macht Gesetzeskonformes Kiffen in der Öffentlichkeit schwierig, wenn nicht in Teilen unmöglich.
Es ändert sich also nichts – genauso wie im Kontrollverhalten der Polizei: Auf Anfrage des Akrützels teilte die Landespolizeiinspektion Jena mit, es sei keine wesentliche Änderung in der Herangehensweise bei der Prüfung von Sachverhalten mit Cannabisprodukten vorgesehen. Die Teillegalisierung könne nicht verhindern, dass in jedem Einzelfall geprüft werden müsse, ob die formulierten strafausschließenden Bedingungen erfüllt seien, oder ob eine Straftat vorliege.
Wie die Polizei die Sichtweite auslegt? Es gebe interne Handlungsanweisungen für die Abschätzung der einzuhaltenden Abstände. Es bleibt abzuwarten, ob unsere Freunde und Helfer im Zweifel mit einem 100 Meter-Maßband auftauchen.
Der Schwarzmarkt bleibt
Der Besitz von Cannabis ist zwar mittlerweile erlaubt – das Cannabis auf der Straße wird jedoch die nächsten Monate weiterhin oft aus illegalen Quellen stammen. Denn: Der Verkauf von Cannabis wird vom CanG ausdrücklich verboten und wird es auch bleiben.
Aber gehen wir das Ganze durch: Wer am 1. April gepflanzt hat, darf nach drei Monaten mit der ersten Ernte rechnen, also frühestens Anfang Juni. Deshalb werden sich wohl die allerwenigsten für den Selbstanbau entscheiden: „Cannabis wächst zwar wie Unkraut, aber richtig gutes Gras ist eine richtige Herausforderung“, sagt Klett und fläzt sich im Campingstuhl. Beim Selfgrowing komme es häufig zu Schimmelbefall und Mikrobenbelastung. Und damit am Ende Geschmack und THC-Gehalt stimmen, müssen die Bedingungen perfekt sein: 22-26 Grad Celsius, siebzig Prozent Luftfeuchtigkeit als Setzling, später fünfzig. Was die Anbaumethoden betrifft, könne man sich an Erfahrungen zum Beispiel aus Ländern wie Kanada orientieren, um die perfekte Produktionstechnik zu erreichen. Mit drei Pflanzen, die man jetzt legal besitzen darf, lässt sich wohl kaum eine Stadt wie Jena versorgen.
Die Cannabisclubs können ihr erstes Gras im großen Maßstab natürlich auch erst ab dem 1. Juli anbauen. Das legt den Zeitpunkt der ersten Ernte wiederum in den September oder Oktober. Der Angriff auf den Schwarzmarkt mit dem 1. Schritt der Legalisierung schlägt also vorerst ins Leere.
In den nächsten Monaten könnte der Schwarzmarkt nochmal ordentlich Profit machen. Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich etwa 200 bis 400 Tonnen Cannabis konsumiert. Geht man von einem durchschnittlichen Straßenpreis von 10 Euro pro Gramm aus, dann liegt auch bei niedrigen Schätzungen der Umsatz bei zwei Milliarden Euro. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Umsatz der deutschen Musikindustrie.
Wie sich der Schwarzmarkt entwickelt, bleibt mindestens bis zum Oktober abzuwarten. In Thüringen schwanken die Zahlen der Kriminalstatistik zu den Cannabis-Straftaten, die vor der Legalisierung begangen wurden – teilweise erheblich. Zuletzt sanken sie. Das liegt natürlich an dem großen Dunkelfeld, das die Statistik nicht abdecken kann. Eine Prognose wäre zur Zeit noch nicht möglich, so die Polizei.
Laut Gottschalk sind die Clubs eine ernsthafte Bedrohung für Dealer:innen.
Was eventuelle Angriffe der Mafia angeht, so habe der Club bereits Sicherheitsvorkehrungen entwickelt, die das Geschäft absichern. Wie diese Vorkehrungen genau aussehen, will er uns jedoch nicht verraten.
„Wir hätten das Potenzial, den Schwarzmarkt zu verdrängen, wenn man uns die Möglichkeiten gibt“, sagt Keno Mennenga, Pressesprecher vom CSC Mariana. Er spricht sein PR-Deutsch, auf eine sympathische Art – als hätte er es mit der Muttermilch aufgesaugt: „Wir hoffen, dass wir den allergrößten Teil des Bedarfes durch die Clubs decken können.“
Der Geschmack und die Qualität der Droge könne durch den professionellen Anbau perfektioniert werden. Die Droge soll nicht mehr verunreinigt und ohne einen extrem hohen THC-Gehalt erworben werden können. Das bekomme man zu einem unschlagbaren Preis. Der Grammpreis läge mit fünf Euro bei der Hälfte des Schwarzmarktpreises. Denn: Die CSCs dürfen keinen Gewinn erwirtschaften. Alle überschüssigen Einnahmen fließen in den Verein zurück.
Der CSC Mariana sieht sich als Schnittstelle zwischen Verein und Start-up und so hört es sich auch an: „Wir wollen nicht kommerziell sein, wir haben nur Bock, etwas aufzubauen.“ Jede Woche muss sich der gewählte Vorstand bei Mariana über Discord Rede und Antwort stellen. Eine von den Mitgliedern aus ihren Reihen gewählte Finanzaufsicht kontrolliert, ob die Entscheidungen auch zum Wohle aller getroffen werden. Es gibt digitale Umfragen und Chaträume: Das schafft eine clubinterne Öffentlichkeit. Kletts und Gottschalks Motivation für die Club-Gründung war die Etablierung einer sozialen und verantwortungsvollen Cannabis-Kultur. Auch Mennenga sagt: „Wir wollen ein echtes Vereinsleben: Karten spielen, Grillen, Wettbewerbe für die schönste gezüchtete Cannabispflanze.“ Die Clubs sollen nicht nur Abholstationen sein. Die Abholung funktioniert beim CSC Mariana ganz ohne Bargeld. Die Mitgliedsbeiträge, gestaffelt von 10 bis 100 Euro, werden auf ein Konto gutgeschrieben. Von diesem Konto bezahlt man dann auch das Gras.
Es gehe auch um den Austausch und die persönliche Begleitung. Das CanG fordert die cannabisbezogene Aufklärungs- und Präventionsarbeit und Beratungs- und Behandlungsangebote. Im CSC Erfurt gibt es daher Sucht-, Jugendschutz- und Präventionsbeauftragte, die sich durch Kurse und Workshops weiterbilden müssen. Es sei enorm wichtig, dass es eine Ansprechperson gibt, die für alle bekannt ist. Die Gefahr der Sucht ist auch für die Social-Clubs ein wichtiges Thema, für das es professionelle Leute braucht. „Der Fallschirm ist unfassbar wichtig, wenn es darauf ankommt“, sagt Mennenga. Das CanG macht den Clubs da einen Strich durch die Rechnung: Kiffen innerhalb der Anbauvereinigungen ist nämlich auch verboten. Diese Regel verhindere, dass ein Safe Space für sicheres und gemeinschaftliches Konsumieren entstehen kann. Auch Gottschalk beschwert sich über die „Antisoziale Regelung“. Das Soziale und Gemeinschaftliche sei wichtiger Bestandteil der Kifferkultur. Gemeinsames Kiffen muss nach dem CanG vorerst in andere Räume außerhalb der Anbauvereinigungen verlagert werden.
Antisoziale Regel
„Die Regel ist dumm! Wir wollen nicht den gleichen Scheiß, den wir beim Alkohol gemacht haben“, sagt der Pressesprecher des CSC Mariana, Keno Mennenga. So fehle etwas ganz Wesentliches: „Du kannst doch niemandem irgendeine Droge in die Hand geben, sei es Tabak oder Alkohol und sagen: Geh mal dahin, wo dich keiner sieht!“
Mit dem derzeitigen CanG, wird Kiffenden kein Raum in der Öffentlichkeit gegeben. Die Logik des Gesetzgebers: „Wir erlauben es, aber wollen es nicht sehen. Als würde man uns doch noch verstecken wollen.“ Mennenga fordert: „Bringt es an das Licht der Öffentlichkeit!“
Auch im Ziel, den Schwarzmarkt zu verdrängen, steht sich das CanG selbst im Weg, so Mennenga. Denn theoretisch können die Behörden die Anzahl der Clubs auf nur einen pro 6000 Einwohner beschränken. „Wenn statt 500 Menschen, die in einen CSC dürfen, 700 Gras konsumieren möchten, dann haben 200 vielleicht keine Möglichkeit, legal an Cannabis zu kommen. Die bleiben dann beim Schwarzmarkt.“
Um den Schwarzmarkt effektiv bekämpfen zu können, bräuchte es doch noch einen dritten Schritt: Die Legalisierung des Verkaufs. Nur auf diese Weise könne auch der Bedarf von unregelmäßig Konsumierenden, die weder anbauen noch Vereinsmitglieder sind, aufgefangen werden.
Die große Hoffnung aller Kiffenden war es, endlich nicht mehr kriminell zu sein. Das hat sich zwar erfüllt. Doch das CanG fördert in der aktuellen Fassung weder die soziale Cannabiskultur und Gesundheitsschutz, noch schöpft sie das Potential der CSCs zur Eindämmung des Schwarzmarktes aus. Die Anbauhalle von Gottschalk und Klett wird wohl hoffentlich bis Mai fertig sein. Ihre Vision ist ein entkriminalisierter Safe Space, innerhalb dem gemeinschaftlich organisiert Gras von bester Qualität konsumiert werden kann. Dafür müssen sie weiterkämpfen.