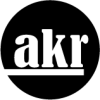Zuhören, Fragen, Sicherheit vermitteln: Im Dialog mit Schauspielenden üben künftige Mediziner:innen Gesprächsführung.
von Carolin Lehmann und Achim Oestermann

Christoph Krah ist kurz vorm Platzen. Seit zwei Wochen wartet er auf einen Termin bei seiner Hausärztin und jetzt ist die nicht mal da?! Stattdessen sitzt ihm irgendeine x-beliebige junge Ärztin gegenüber, die aussieht, als sei sie gerade frisch der Uni entschlüpft. Als sie ihn fragt, was ihn denn nun zu ihr führe, explodiert er: „Sagen Sie mal, wolln Sie mich eigentlich verarschen?! Ich sterbe bald an einem Hirntumor und Sie lassen mich ne Stunde im Wartezimmer sitzen?“
Doch eigentlich heißt Christoph Krah nicht Christoph Krah, neigt nicht zu Wutausbrüchen und ist auch (hoffentlich) weit entfernt von einem Hirntumor. Achim, 24, studiert Deutsch als Fremdsprache und ist ein paar Mal im Semester als Schauspielpatient tätig. Echt ist hier überhaupt wenig: Die „Ärztin“ ist eine Medizinstudierende im dritten Semester und statt anatomischer Poster und Stethoskope sind zehn andere Studierende um sie gruppiert und beobachten das Ganze.
Auf den Brettern, die das Testat bedeuten
Im Kurs „Medizinische Psychologie und Soziologie“ erlernen die Teilnehmenden Grundlagen der Gesprächsführung zwischen Mediziner:in und Patient:in. Denn wer hat sich nicht schon einmal unverstanden gefühlt, nicht ernst genommen oder ärgerlich nach einem Ärzt:innenbesuch? Zuhören und adäquat reagieren zu können, auch bei unbequemen Patient:innen, ist mindestens so wichtig für den späteren Beruf wie Anatomie oder Biochemie. Heute geht es um den Umgang mit heftigen Emotionen: Was tun als Ärzt:in, wenn Patient:innen ihre Angst, Aufregung oder Wut ungefiltert auslassen? Wie kann man jemanden ernst nehmen und beruhigen, ohne dessen Erregung kleinzureden?
Während die Studierenden alias Ärzt:innen sich vor und im Gespräch viel Druck machen, haben die Schauspielpatient:innen vor allem Spaß. „Und was hast Du heute schon so gemacht?“ – „Ach, ich hab heute mal wieder jemanden zum Weinen gebracht.“ Definitiv ein guter Eisbrecher fürs Mensagespräch.
Eine Schulung soll auf die Rollen vorbereiten. Bei dieser Schulung kriecht nicht etwa ein Haufen Schauspieler:innen als Tiere durch die Gegend oder deklamiert kunstvoll Verse. Die Schauspielpatient:innen – größtenteils Studierende – üben, sich vollkommen auf das Gespräch einzulassen und zu erfühlen, wie Aussagen, Gestik und Mimik der Ärzt:innen auf Patient:innen wirken. So eine Rolle kann auch mal auf die eigene Stimmung abfärben – vor allem wenn es um Antriebslosigkeit und Depression geht. Deshalb ist es mindestens genauso wichtig zu lernen, die Rollen nach dem Spielen wieder abzuschütteln, sich „auszurollen“. Aber zurück zum Fall Christoph Krah. Anna entschuldigt sich für die lange Wartezeit, erklärt, warum sie seine Hausärztin vertritt und spricht direkt den MRT-Befund an: Der ist – puh – unauffällig. Krah ist sichtlich erleichtert: Seine Ängste waren unbegründet, er hat keinen Hirntumor. Die Ärztin stellt noch einige Standardfragen und schickt ihn zur weiteren Abklärung des Kopfschmerzes zu einem Neurologen. Zum Schluss entlässt sie einen beruhigten Patienten nach Hause.
Ist dies auch Wahnsinn, so hat es doch Methode
Nach dem Gespräch wirkt Anna erleichtert. Sie sei sehr aufgeregt gewesen, erzählt sie. Achim lässt in seinen Kopf hineinschauen: Die ruhige Ausstrahlung und die Entschuldigungen der Ärztin hätten seinen Ärger schnell runtergekühlt; ihr aufmerksames Zuhören und die stringente Struktur des Gesprächs vermittelten ihm als leicht überbesorgten Patienten einen Eindruck von Kompetenz und Sicherheit. Ein gelungenes Gespräch, finden auch Annas Kommiliton:innen. Dass Anna das Rätsel um Herrn Krahs Kopfschmerzen letztlich nicht geknackt hat, ist sekundär. Es geht darum, auf den Patienten einzugehen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen.
Jetzt wollen natürlich trotzdem alle wissen, warum der Schädel drückt. In einer kleinen Randbemerkung des Patienten wäre der Schlüssel versteckt gewesen: „Beim Lesen verschwimmt mir immer alles vor Augen“. Des Problems Lösung kann manchmal so einfach sein: Eine Brille.