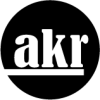Ivanna stammt aus der Westukraine. Seit 4 Jahren lebt sie in Deutschland und studiert Wirtschaftswissenschaften an der FSU. Sie berichtet, wie sie den Ukraine-Krieg erlebt.
Gesprächsprotokoll: Johanna Heym und Stephan Lock

Als der Krieg am 24. Februar begann, war ich in Deutschland. Ich habe zu dieser Zeit nicht aktiv die ukrainischen Nachrichten verfolgt. Vom Krieg habe ich daher von meiner besten Freundin erfahren. Ich bin aufgestanden, schaute auf mein Handy und habe die Nachricht von ihr gesehen. Es war eine Videonachricht in Telegram. Sie weinte, im Hintergrund war der Luftalarm zu hören. Sie sagte: „Es hat begonnen.“ Das war der größte Schock meines Lebens. Kurz darauf bekam ich noch eine andere Nachricht von meinem besten Freund aus der Kindheit. Er schickte mir ein Video davon, wie der Flughafen bombardiert wurde.
Ich komme ursprünglich aus der Westukraine, aus einem Dorf in der Nähe von Iwano-Frankiwsk. Da viele Mitglieder meiner Familie in der ukrainischen Partisanenarmee waren, habe ich seit meiner Kindheit viele Geschichten über russische Soldaten gehört.
Kein Alltag
Als ich diese ersten Nachrichten gesehen hatte, konnte ich mich nicht beruhigen und kaum atmen. Ich wollte das nicht glauben. Das erste Mal habe ich in der ersten Kriegswoche geweint. Ich verschob meine Prüfungsphase, weil ich nicht mehr lernen konnte. Ich war die ganze Zeit am Handy, um Nachrichten in Telegram-Kanälen zu verfolgen. Ich konnte mich einfach nicht auf meinen Alltag konzentrieren. Nicht kochen, nicht aufräumen. In mir fanden immer wieder Kreisläufe von Emotionen statt – Frustration und Hass, immer wieder.
Später habe ich versucht, weniger Nachrichten und mehr Analytisches anzuschauen. Das rationale Denken beruhigt ein bisschen.
Das zweite Mal habe ich dann geweint, als die russische Armee aus der Region Kiew verdrängt wurde und die Region verlassen hat. Ich habe auch eine Freundin aus Butscha, mit der ich zusammen in Erfurt studiert und in einem Studentenwohnheim gelebt habe. Zu Kriegsbeginn war sie gerade in Butscha. Als ich sie kontaktiert habe, hatte sie bereits eine ganze Nacht im Keller verbracht. Dann verlor ich zu ihr den Kontakt für mehr als 24 Stunden. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, aber sie schaffte es in den ersten Tagen raus.
Verluste
Und das dritte Mal habe ich geweint, als ich erfahren habe, wer aus meinem Dorf schon als Freiwilliger in die Armee eingetreten ist und wer aufgrund von Vorerfahrung einberufen wurde. Ich kannte viele von ihnen persönlich, wodurch der Krieg noch realer wurde als zuvor.
Zum Beispiel ist ein Junge, in den ich als Kind verliebt war, in Krakiw verschwunden. Seine Familie hat seit einem Monat keinen Kontakt mehr zu ihm. Das ist einfach sehr schwer zu begreifen.
Da mein Vater viele schlechte Erfahrungen mit Russen gemacht hatte, riet er mir immer, mich in Acht zu nehmen. Er selbst hat in der Sowjetunion studiert und anschließend in Russland gearbeitet. Obwohl ich eine patriotische Erziehung genossen habe, hatte ich mit ihm viele Meinungsverschiedenheiten. Ich war genervt, dass er das so generalisiert. Ich sagte immer: „Nicht alle sind so.“ Nach dem Kriegsbeginn habe ich mich aber bei meinem Vater entschuldigt, weil es jetzt für mich so aussieht, dass das Meiste, was er erzählt, der Wahrheit entspricht. Das, was über die Generationen mit der Ukraine in der Vergangenheit passierte, passiert auch jetzt. Und es scheint zu sein, dass die Russen so sind.
Hilfe
Jetzt beginnt das neue Semester, ich versuche, mehr zu lernen und weniger Nachrichten zu schauen. In manchen Vorlesungen wird über den Krieg diskutiert, aber die vielen Theorien machen das Ganze nicht leichter.
Ich versuche jetzt parallel zum Studium ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Das ist alles, was ich machen kann und was mich davor rettet, mit meinen Gedanken allein zu bleiben. Ich helfe unterschiedlichen Familien, Wohnungen zu suchen, indem ich zwischen Flüchtlingen, Vermietern und Sozialamt vermittle.
Was bleibt, ist die kognitive Dissonanz zwischen den Gefühlen und Realitäten in der Ukraine und in Deutschland. Es war am Anfang unglaublich schwer zu verstehen, wie hier alle happy sind, ins Restaurant gehen und die Zeit nett verbringen wollen. Die Freunde und Bekannten aus Deutschland fragen mich immer mal, wie es mir geht. Aber ich habe nach einer Weile gemerkt, dass die Meisten einfach nicht so viel von den schrecklichen Sachen hören wollen.
Am meisten hilft mir zur Zeit der ukrainische Humor, mit der Situation umzugehen. Er gibt mir Hoffnung. Ich habe ukrainische Youtuber für mich entdeckt, die mich zum Lachen bringen. Ich denke auch, dass mir der Krieg ein bisschen die Angst vor meiner Zukunft genommen hat. Ich blicke jetzt selbstbewusster auf meinen eigenen Weg und möchte mich in meiner späteren Arbeit unbedingt für die Ukraine engagieren.