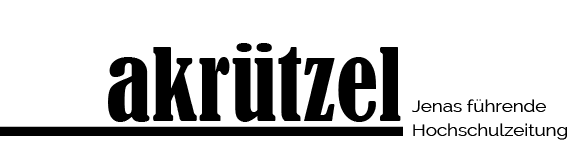Emotional, unangenehm und nichts zum Berieseln. Zink schafft, womit Deutschlehrerinnen sich schwer tun: Es zieht in den Bann von Faust.
von Johanna Hungerer und Alexander Bernet
Keine eigenen Umkleiden, das Bühnenbild besteht aus drei Türen, die an eine Schultoilette erinnern, und Gott muss im Schankhaus aushelfen – es ist wenig Glamour am Amateurtheater. Präsentiert vom Theater Zink und der Freien Bühne wetten Gott und der Teufel auf den Brettern der Philomensa um die Seele eines rechtschaffenen Geistes: Faust.
„Endlich wieder Theater, und dann gleich so ein Klassiker“, würde man denken, schließlich gehört Goethes „Faust“ in manchen Bundesländern als einziges Werk zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht der Oberstufe. „Hoffentlich wird es nicht zu modern“, war dann auch ein paar Minuten vor Beginn in den hinteren Reihen zu hören. Wer sich auf eine unbefleckte Originaltext-Inszenierung gefreut hatte, muss in den folgenden zwei Stunden einiges über sich ergehen lassen.
Sobald sich der Vorhang öffnet, heißt es, Faust sei nur die „Masturbationsvorlage eines alten Mannes“: Goethes antiquiertes Machwerk zeigt sich von seiner hässlichsten Seite. Ein 80-Jähriger schläft mit einer 14-Jährigen, die anschließend erst verzweifelt, dann durchdreht, das entstandene Kind umbringt und dafür auch noch in den Kerker kommt. Die Regie geht das Risiko ein, die Szenen zu überspitzen, deutlich zu machen, was hinter den schönen Worten passiert und sie unkommentiert zu lassen – Prinzip „In-your-face-theatre“.
Statt dem Publikum eine fertige Interpretation zu präsentieren, setzen sie auf mündige Zuschauer:innen, die von selbst erkennen können, dass die schockierendsten Szenen die sind, die auch heute noch so passieren könnten. Dass Gretchen als Charakter für eine von vielen Frauen steht, die die Konsequenzen patriarchaler Strukturen tragen müssen. Um sich dann anzuhören: „Du bringst mich um“ und „Lass das Vergangne vergangen sein“.
„Wir hatten keinen Raum, kein Geld, keinen Faust und wollten Faust inszenieren“
Lukas und Pauline, die beiden Regieleute, wollten zeigen, dass man mehr aus Faust machen kann als „Mephisto und Gott haben eine Wette“. Dazu haben die beiden die Gelehrtentragödie komplett gestrichen: „hashtag fuck the Gelehrtentragödie“. Statt des in der Midlife-Crisis versunkenen Intellektuellen sollte die Gretchentragödie in den Fokus gerückt werden.
Die Regie hegt Ideen zur Faust-Inszenierung bereits seit sechs Jahren; Kenner des Werks merken, wie geschickt die Anteile aus den verschiedenen Versionen zusammengekürzt und -gesucht sind. So findet man sowohl Szenen aus dem Urfaust als auch beide Walpurgisnächte wieder, vor denen sich Goethe selbst gegraust haben soll. Darin kommt vor, wie Schwänze riechen oder wie man einen Anus küsst.

Die Inszenierung ist ein feuriges Intermezzo aus einer Passage aus Schillers Handschuh, selbstgeschriebenen Musikstücken, einer Ein-Frau-live-Kapelle mit diversen Instrumenten und Effekten, Rammstein, der Ode an die Freude und Bierzeltstimmung. Hinzugedichtet wurden außerdem zwei weitere Szenen: zum einen das vom Ensemble genannte „Bibelduell“ und Gretchens Kreuzigung. Erstere folgt auf die berühmte Gretchenfrage „Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“ Faust weicht aus, antwortet, er möge seinen Glauben nicht an solche Dinge wie die Bibel binden.
Es folgt ein Auftritt der Priesterschaft samt Mephisto und Gott, die sich, untermalt von grellem Stroboskoplicht, mit Zitaten aus der Bibel beschimpfen. Die eine Seite spricht von Nächstenliebe, Vergebung und Geborgenheit, die andere antwortet mit fremden- und frauenfeindlichen Versen, die ebenso aus der heiligen Schrift stammen. Den Höhepunkt der Vorstellung stellt die Hinrichtung von Gretchen dar, als diese symbolisch von der Gesellschaft ans Kreuz geschlagen wird, ein beeindruckendes Bild auf der Bühne.
Doch das wirklich Schockierende ist, was das Ensemble währenddessen verkündet: „So wie die angezogen war, wollte die das doch“, „Noch schöner wärst du nur mit meinem Schwanz in deinem Mund“ oder „Eine fette Fotze kann gar keine zehn sein“ und vieles mehr – alles Sprüche und Texte, die aus eigenen, persönlichen Begegnungen der Schauspieler:innen stammen. Die Bestürzung darüber sitzt einem tief in den Knochen, während der Vorhang langsam zugezogen wird und Schillers Ode an die Freude, Mephistos Leitmotiv, durch und durch, in vollem orchestralen Umfang über einem zusammenschlägt. Der große Wurf sei gelungen, das holde Weib errungen, die Hure gerichtet.
Dann ist es erstmal still, das Publikum traut sich nicht zu klatschen, zu plötzlich scheint das Ende gekommen, zu fassungslos sind die Gesichter. Das Publikum ist entsetzt, krümmt sich auf den Stühlen vor Abscheu gegen das Gezeigte. Dann trauen sich die ersten und schließlich bekommt das Team seine wohlverdiente Anerkennung.
Kein Krippenspiel, sondern Theater
Die Inszenierung ist ein grandiose Umsetzung von Schillers Theatertheorie, in der die Figuren auf der Bühne dem Urteil des Publikums unterworfen sein sollen. Theater soll keine Wohlfühlveranstaltung sein. Das Publikum darf nicht faul werden, sondern muss die gezeigten Szenen hinterfragen und darüber nachdenken. Wer das tut, bemerkt auch, dass es der Regie ein wichtiges Anliegen ist, herauszuarbeiten, dass nicht die Männer die Schuld an allem tragen. Eher ist es eine Mischung aus den jahrhundertealten Strukturen, einer gefährlichen Akzeptanz und der Wehrlosigkeit der Opfer.
Ganz besonders kommt man ins Grübeln, als Gretchen im Kerker vollkommen durchdreht und in wenigen Minuten alle menschlichen Emotionen durchläuft, von Verzweiflung über kindliche Neugier, Hoffnung und Trauer und schließlich einem durchdringenden Urschrei. Warum wird sie so allein gelassen, warum ist ihr Schicksal der Öffentlichkeit so gleichgültig? Erschüttert wird der Zuschauer, die Zuschauerin von Fausts Selbstsucht, als er in dieser katastrophalen Situation noch versucht, sie davon zu überzeugen, dass er hier das Opfer sei. Durchaus nimmt er wahr, was sein Handeln anrichtet, doch sind ihm ihre Gefühle und ultimativ ihre Unversehrtheit und Schicksal egal. Er nennt Gretchen, das reine Gretchen, welches konsequent seine Zigaretten ablehnt, einen „ahnungsvollen Engel“, als sie von ihrer instinktiven Abneigung gegen Mephisto spricht.
Faust lockert sich gleichzeitig die Krawatte mit demselben provozierend grellbunten Muster wie Mephistos Anzug, das Symbol für die Vermischung der beiden Charaktere. Fast erwartet man ein Umdenken, ein Aufbegehren gegen Mephisto, aber im Endeffekt zieht er sie doch wieder fest, bindet sich noch enger an seine Gelüste. In diesen raffinierten Details liegt die Tiefe der Inszenierung.
Gänsehaut bekommt man auch, wenn man realisiert, dass sich die Darsteller:innen zwei Stunden lang ebenfalls sehr grenzüberschreitend berühren und sich körperlich sowie emotional sehr nahe kommen. Wie es funktioniert, dass sie sich wohl damit fühlen, geküsst, angeschrien und geschlagen zu werden, erklärt uns die Regie im Vorgespräch: Schauspielende, die ein Stück über Grenzübertritte machen, sollten sich zuallererst ihrer eigenen Grenzen bewusst sein. Es sei ein Raum geschaffen worden, „wo man auch ‚Stop‘ sagen kann“. Das merkt man dem Ensemble an, es existiert eine starke Vertrautheit, was die Intensität des Stücks potenziert. Mit dem Verständnis über eben dieses Bewusstsein für Schwellen kann man den Theatersaal beruhigter verlassen, ohne dass es den unangenehmen Nachgeschmack verliert.
Goethe ist nun einmal Goethe
Alles in allem geht es nicht nur um die Unterdrückung der Frau und die Männergesellschaft, sondern auch, wie über Goethe selbst zu urteilen ist. Wie es zu bewerten sei, dass er seinen Faust derart angelegt hat. Die Aufführung startet mit seinem Porträt in voller Größe über der Bühne, der große Dichter übersieht sein Stück und wird im Laufe der zwei Stunden immer weiter abgesenkt, bis es schließlich zur Kreuzigung ganz verschwunden ist. Geschähe ihm recht, diese Herabwürdigung, ist die offenkundige Botschaft. Im Gespräch hat die Regie zum Ausdruck gebracht, sie fänden es ein Unding, dass dieses „Meisterwerk der deutschen Lyrik“ immer noch das Paradebeispiel für deutsche Literatur sei.
Da müsse man doch aufmerksam werden, Kritik sei mehr als angebracht. Eine Haltung, die man nach dem Anschauen der Inszenierung nur zu gerne bestätigen möchte, es ist geradezu undenkbar, Lob für das Werk zu finden. Doch macht man es sich damit nicht ein bisschen einfach? Schließlich wird Faust ja nicht einfach nur konsumiert, sondern im Gegenteil immer wieder aufs Neue interpretiert – so sehr sogar, dass eigentlich gar nicht mehr die Geschichte an sich oder „was der Autor damit sagen wollte“ sondern die Bedeutung für die Literatur der Grund für die Aufnahme in die deutschen Lehrpläne ist.
Der Grund für die immer noch anhaltende, immense Popularität des Dramas ist doch gerade, dass es so viel Anlass bietet, sich den Kopf zu zerbrechen und mehr oder minder schlaue Dinge dazu zu sagen. Es ist doch bemerkenswert, dass selbst dieses Ensemble zugeben muss: Es steckt immens viel in diesen Versen. So viel, dass man bei entsprechender Behandlung auch ein feministisches Stück daraus machen kann. An Faust kommt man einfach nicht vorbei.