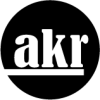Kurzinterview mit Mitarbeitern am Lehrstuhl für Textlinguistik über das Interview mit Khalid Amayreh in der Unique
Von Dirk Hertrampf
Eva Leuschner und Robert Beyer sind wissenschaftliche Mitarbeiter bei Monika Schwarz-Friesel, Professorin für Textlinguistik und Pragmatik am Institut für germanistische Sprachwissenschaft. Sie untersuchen die sprachlichen Formen des aktuellen Antisemitismus in Deutschland, besonders in Bezug auf die Berichterstattung zum Nahost-Konflikt.
Frau Leuschner, Herr Beyer, was ist aus Ihrer Sicht das Brisante am Interview mit Khalid Amayreh?
Beyer: In der Vorrede zum Artikel wird der Anspruch postuliert, „unbefangen“ den Nahost-Konflikt darzustellen. Dies geschieht keinesfalls. Vielmehr wird dem Interviewten die Möglichkeit geboten, seine einseitige Sicht des Konflikts darzustellen. Es wird eine einseitige Täter-Opfer-Sicht dargestellt, die Israel dämonisiert und dehumanisiert. Es werden seitens des Journalisten keine kritischen Nachfragen gestellt oder offensichtliche Widersprüche in Amayrehs Äußerungen aufgelöst, so zum Beispiel die Aussage, die Hamas gestehe Israel zwar kein Existenzrecht zu, erkenne jedoch seine „physische Präsenz“ an.
Leuschner: Selbst wenn offensichtlich falsche Aussagen gemacht werden – so etwa, dass die Hamas nichts gegen Juden als Juden habe, wohingegen die nach wie vor gültige Charta der Hamas das genaue Gegenteil zeigt – fragt Fabian Köhler nicht nach. Dieses Unterlassen deutet darauf hin, dass Köhler mit Amayrehs Aussagen, die eben nicht den Tatsachen entsprechen, konform geht. Problematisch ist, dass der Leser so ein völlig verzerrtes Bild vom Nahost-Konflikt gewinnt.
Sind Amayrehs Äußerungen antisemitisch?
Leuschner: Zunächst einmal sind sie antiisraelisch, d.h. monoperspektivisch, stark emotionalisierend, dämonisierend und dehumanisierend; als Konsequenz dieser Sicht wird die Existenz des Staates Israel abgelehnt. Amayreh stellt Israel als alleinigen Aggressor dar und die Palästinenser als Opfer, welche gezwungen sind, „sich falsch zu verhalten“, jedoch lediglich Widerstand gegen eine „schändliche Militärbesatzung“ leisten. Der Raketenbeschuss auf Israel wird bagatellisiert, indem von „hausgemachte[n] Projektile[n] mit geringer Wirkung“ die Rede ist.
Beyer: Antisemitisch wird es, wenn Amayreh beginnt, vom „krebsartigen Wachstum jüdischer Siedlungen“ und von „nazihafte[n] Blockaden“ zu sprechen, und Gaza mit dem Warschauer Ghetto vergleicht. Dabei bedient er sich eindeutig antisemitischer Muster und Stereotype und – die Krebsmetapher betreffend – einer Sprache, die jener des 3. Reiches ähnelt. Köhlers dies betreffender Kommentar, die Kritik an NS-Vergleichen sei ein bloßes Verweisen auf Rhetorik, um missliebige Positionen zu delegitimieren, ist mehr als problematisch und stützt die Analogien Amayrehs.
Leuschner: Insofern ist es gefährlich, Amayrehs antisemitische Sicht „unbefangen“ darzustellen und so den Anschein zu erwecken, sie wäre eine legitime Sichtweise des Konflikts.
Was würden Sie, neben den ausbleibenden Nachfragen, noch an der journalistischen Art kritisieren, mit der das Interview geführt wurde?
Leuschner: Die Fragen des Journalisten sind gespickt mit Implikaturen [Äußerungen, deren kommunikative Bedeutung im geäußerten Kontext über die wortwörtliche Bedeutung hinausgeht bzw. eine weitere oder andere Bedeutung meint., Anm. der Redaktion], und werden nicht der geforderten journalistischen Objektivität gerecht. So etwa „Manchmal scheint es, als sei nicht Israel, sondern die Fatah der größte Feind der Hamas“, oder „Wo bleibt der viel gepriesene Widerstand der Hamas gegen die Besatzung?“. Diese Fragen lassen keinen Zweifel daran, dass Köhler in Israel den einzigen Feind für die Hamas sieht, und dass er den faktischen Terror gegen Israel als unzureichend empfindet und als Widerstand konzeptualisiert.
Beyer: Insofern kann er sich nicht auf den Duktus des unbefangenen Journalisten zurückziehen! Darüber hinaus ignoriert er die Tatsache, dass Medien gesellschaftliche Realitäten schaffen. Und was für eine Realität schaffen Köhler und Amayreh mit diesem Interview?
Frau Leuschner, Herr Beyer, vielen Dank für das Gespräch.