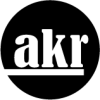Puccinis „Turandot“ feierte am Weimarer DNT Premiere
Von Johannes Weiß
 |
| “Nun, Fremdling, das Eis, das Feuer gibt, was ist es?”                 Â
Foto: Charlotte Burchard |
Manchen mag es überraschen: Trotz ihrer vergleichsweise geringen Dauer von nur zwei Stunden besteht Puccinis Oper „Turandot“ nicht nur aus dem Schlager „Nessun dorma“ – bekannt aus Funk und Fernsehen und zuletzt so ergreifend mittelmäßig interpretiert von Kitschnudel Paul Potts. Da wirkt es fast schon wie ein ironischer Kommentar, dass Andrea Moses mit ihrer Ende März angelaufenen Turandot-Inszenierung am DNT Weimar gerade die Macht der Medien und deren suggestiven Einfluss auf die Massen thematisiert.
Die letzte und unvollendet gebliebene Oper Puccinis handelt von der chinesischen Prinzessin Turandot, die jedem Bewerber um ihre Hand drei Fragen stellt; kann er diese nicht korrekt beantworten, muss er seine Unwissenheit mit dem Leben bezahlen. Auf der Weimarer Bühne wird das Ratespiel samt nachfolgender „Live-Hinrichtung“ zum Medienspektakel: Schwarz-weiß gekleidete und Champagner schlürfende Touristen besetzen die Ränge eines arenaförmigen Fernsehstudios; der Mandarin (Philipp Meierhöfer) erscheint nicht als gewissenhafter Beamter, sondern als schillernder Conférencier mit Schlaghose und Plateauschuhen. Mit Hilfe von beschrifteten Schildern, auf denen im Stück vorkommende Schlagwörter wie „enigmi“, „sangue“ oder „morte“ stehen, stimmt er das Publikum auf das kommende Event ein: die Ermordung des Prinzen von Persien, des letzten glücklosen Kandidaten.
Alles wird Teil einer gigantischen medialen Inszenierung: Der vom Chor besungene Mond ist eine Diskokugel, und eine Cheerleadergruppe eröffnet den Abend in „Turandot‘s Riddle Club“. Die Prinzessin selbst (Catherine Foster) tritt als schwarz gekleidete und vermummte Henkerin auf, die den gescheiterten Brautwerber eigenhändig tötet. Und das Jetset-Publikum nimmt dies mit ebenso großem Wohlgefallen auf wie die artig beklatschte Arie der Sklavin Liu (Larissa Krokhina), die ihren geliebten Prinzen Calaf (Ki-Chun Park) vor dem selben tragischen Schicksal bewahren will. Emotionen werden zu Konsumgütern. Alles Wahre, Authentische verschwindet hinter der glänzenden Oberfläche des hübschen Scheins; selbst die drei Minister Ping (Alexander Günther), Pang (Artjom Korotkov) und Pong (Frieder Aurich) sind bloße Entertainer, die zu Beginn des zweiten Akts – zu sehen per Videoübertragung – in der „Maske“ sitzen und schließlich auf der Bühne eine schnulzige, erschreckend gut zu Puccinis Musik passende Gesangs- und Tanzeinlage zum Besten geben.
Inzwischen laufen die Vorbereitungen zur nächsten Ausgabe von „Turandot‘s Riddle Club“ auf Hochtouren: Calaf stellt sich in Anzug und Krawatte der tödlichen Raterunde, und der ganz in Weiß gekleidete Kaiser Altoum (Klaus Gerber) grüßt die Menge mit dem Victory-Zeichen, bevor er auf der VIP-Tribüne Platz nimmt. Die Aufmachung des Studios erinnert an gewisse Quizformate des Privatfernsehens; doch im Gegensatz zu Günther Jauch schafft es Moderatorin Turandot nicht, den Kandidaten zu verunsichern, und so löst Calaf ohne Publikumsjoker alle drei Rätsel.
Das glückliche Ende muss allerdings noch eineinhalb Akte auf sich warten lassen, denn Calaf will nicht nur die Hand, sondern außerdem das Herz der Prinzessin gewinnen. Dafür verschmäht er sogar die Geldscheine, Kreditkarten, Autoschlüssel und anmutigen Frauen, die ihm die drei Minister ersatzweise anbieten. In einem im Programmheft abgedruckten Essay deutet der Dramaturg der Inszenierung, Michael Dißmeier, den Prinzen Calaf als einen „Superhelden“, der aus Macht- und Ruhmessucht die „Femme fatale“ Turandot bezwingen und damit ein Übermenschentum im Sinne Nietzsches und des Puccini-Zeitgenossen D’Annunzio verwirklichen will. So überrascht es nicht, dass selbst das triumphale Ende noch Schatten wirft: Die beiden Egozentriker Turandot und Calaf umarmen sich und gehen voller Leidenschaft inmitten von Leichnamen zu Boden. Denn zuvor hat der Cheerleader-Chor mit Hilfe von Golfschlägern die Ausgegrenzten, ärmlich gekleidete Obdachlose, für immer aus der Welt der Reichen und Schönen entfernt.
Weimar ist ein gutes Pflaster für Puccini-Anhänger. Nach der letztjährigen „Tosca“ erscheint nun wieder eine überaus überzeugende Inszenierung, die unsere von den Massenmedien geprägte Alltagswelt einbindet und doch nie das Original aus dem Blick verliert. In gewohnter Qualität agieren auch die Gesangssolisten, die Chöre und die Staatskapelle Weimar unter Leitung von Will Humburg. So ist für jeden etwas dabei: für die Freunde einer frischen und intelligenten Auseinandersetzung mit Puccinis Werk, und für die Freunde von „Nessun dorma“.