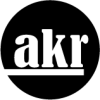Ostdeutsche Jungs mit Seitenscheitel, Rechtsrock und Nazi-Symbole auf TikTok
– Gibt es eine neue rechte Jugendkultur? Vier Jugendliche aus Jena berichten von ihren Erfahrungen mit Rechtsextremismus.
Ein junges Mädchen blickt lasziv in die Kamera und bewegt ihre Lippen zu einem Marschlied der SS. Sie steht vor einer Deutschlandflagge, die sie an ihre Wand gepinnt hat. Neben der Fahne hängt das Bild eines Reichsadlers mit Eichenkranz, einem Symbol des Nationalsozialismus. Ohne die Nazi-Symbolik wäre es das Zimmer einer normalen Teenagerin. Die Wände sind rosa gestrichen, im Bett liegt ein Plüschpferd und ein Traumfänger hängt an der Wand.
In den über 600 Kommentaren unter ihrem TikTok-Video bekommt die rechtsextreme Influencerin aus Brandenburg viel Zuspruch, vor allem von jungen Männern. Ein Nutzer kommentiert: „würde jede Frau der Welt für sie verlassen”, ein anderer reagiert mit den Worten: „instant Heiratsantrag“. Zwischen die Liebesbekundungen mischt sich offen nationalsozialistische Symbolik. Ein TikTok-Nutzer kommentiert das Video mit der Parole der Hitlerjugend „Blut und Ehre“. Ein anderer postet zwei Blitz-Smileys, ein Symbol, mit dem in der rechtsextremen Online-Community auf die SS verwiesen wird.
Rechtsextreme Trends auf TikTok
Dieses Video ist nur eines von vielen. Besonders auf TikTok präsentiert sich eine jugendliche Subkultur. Unter dem Hashtag „Deutsche Jugend voran“ erscheinen Videos von jungen Männern, die in The North Face Jacken durch die Stadt marschieren. Die Marke ist durch die Anspielung auf das rassistische Idealbild einer nördlichen, weißen Erscheinung ungewollt zu einem Erkennungsmerkmal der rechtsextremen Jugendszene geworden.
Szenemusik ist ein weiteres Erkennungszeichen der Subkultur auf TikTok. Ein rothaariges Mädchen lip synct vor einer Reichsflagge zu einem Lied der rechtsextremen Band Frontalkraft. Lässig singt sie die Zeilen: „Schwarz ist die Nacht, in der wir euch kriegen, weiß sind die Männer, die für Deutschland siegen, rot ist das Blut auf dem Asphalt“ in die Kamera. In anderen Videos filmen sich junge Männer dabei, wie sie sich gegenseitig einen Seitenscheitel schneiden. Den Trend setzte Eric Engelhardt, der vor der Auflösung der Jungen Alternative der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen war. In einem TikTok verkündet Engelhardt seinen Follower:innen: „Die ostdeutsche Jugend trägt Scheitel“. Ostdeutsche Jugendliche sollen mit ihrer Frisur zeigen, ob sie „heimatverbunden und patriotisch“ oder „links und selbstzerstörerisch“ sind.
Der Eindruck einer rechtsextremen Jugendkultur entsteht nicht allein auf TikTok. Die rechtsextreme Subkultur wird in Sportvereine, Jugendclubs und auf Thüringer Schulhöfe getragen.
Darwin (18)
Darwin ist 18 Jahre alt und geht in die zehnte Klasse einer Gemeinschaftsschule in Lobeda. In seinem Jahrgang seien seit der Isolation während der Corona-Pandemie überwiegend rechte Freund:innengruppen entstanden. Sowohl zu Hause in Lobeda-West als auch in der Schule werde er täglich von der Mehrheit seiner Mitschüler:innen mit rechtem Gedankengut konfrontiert. Dabei sei es nicht immer leicht, dagegenzuhalten.
Er selbst sagt dazu: “Ich denke mir da meinen eigenen Teil. Meine Mutter ist ja auch aus Tschechien hergezogen. Ich finde, jeder hat hier seine Daseinsberechtigung.”
Die Reels, in denen Jungen und Mädchen selbstbewusst Nazi-Symbolik präsentieren, würden permanent im Jahrgang der Gemeinschaftsschule herumgeschickt werden und sorgen für rechtes Trendsetting. Neben Adidas und New Balance Sneakern seien auch Lederjacken mit aufgenähten rechtsextremen Zeichen und Stickern angesagt. Als Musik werde verbotener rechtsextremer Rock gehört.
„Das ist auch wirklich kein Spaß mehr, die leben das ja auch aus”, sagt Darwin. Mitschüler:innen, die nicht dem rechten Trend folgen, würden ausgegrenzt oder fertig gemacht. Außerdem würden Hakenkreuze an die Tafel gemalt und ausländische Mitschüler:innen beschimpft. Eine Lehrerin, die mit dem Fahrrad zur Schule fährt, werde als „grün versifft” beleidigt. Man wolle ihre Reifen zerstechen.
Projekte wie Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage sollen helfen. Mitmachen würden aber vor allem diejenigen, die sich sowieso schon außerhalb der rechten Bubble bewegen. Außerdem werde in der Schule kaum Medienkompetenz vermittelt. Jeden Montag schaue man gemeinsam die Tagesschau, die manipulativen Auswirkungen von Social Media würden jedoch nicht diskutiert.
Rechtsextreme im Kindergarten?
Auch Yasmin* ist mit rechten Mitschüler:innen konfrontiert. Die 18-Jährige macht eine Ausbildung zur Erzieherin an einer Berufsfachschule in Lobeda. Im Gespräch erzählt sie von ihren Klassenkamerad:innen, die fast alle die AfD wählen würden. Vor allem einer ihrer Mitschüler störe regelmäßig den Unterricht mit rechtsextremen Äußerungen. Eine Situation habe sie besonders schockiert: Als in der Klasse über das anstehende Praktikum im Kindergarten gesprochen wurde, äußerte ihr Mitschüler, dass er am liebsten in einem Kindergarten arbeiten wolle, in den nur deutsche Kinder gehen. Ausländische Kinder finde er „eklig“. Mit solchen Aussagen knüpft der 16-jährige Schüler an rassistische Narrative an. In der Propaganda des Nationalsozialismus wurde Ekel eingesetzt, um Gruppen zu entmenschlichen und Gewalt gegen sie zu legitimieren. So wurden Jüd:innen als „unrein” bezeichnet und mit Ungeziefer verglichen.
Yasmin sagt zu dem Vorfall: „Wenn du Erzieher werden möchtest, dann ist das nicht der richtige Ort für dich“. Sie wirkt selbstbewusst, auch wenn sie in der Klasse bereits selbst zur Angriffsfläche wurde. Der gleiche Mitschüler habe vorgeschlagen, sie nach Peru abzuschieben. In das Land, in dem sie bis vor sechs Jahren lebte. Solche Aussagen nehme sie nicht persönlich, erzählt Yasmin. Lachend fügt sie hinzu: „Schiebt mich nach Peru ab, bei der Situation in Deutschland bin ich da glücklicher“. Dann wird sie wieder ernst, denn es gebe genug Menschen, die solche Sätze verletzen. Auch wenn sie einen guten Umgang mit der Situation findet, belaste der Unterricht Yasmin manchmal sehr. Die Lehrer:innen würden sich laut Yasmin meistens aus den Situationen heraushalten. Konsequenzen für die rechtsextremen Äußerungen seien noch nicht erfolgt. Im Ernstfall ist sich Yasmin aber sicher, dass man sich für sie einsetzen würde.
Clara (20)
Hitlergrüße waren für Clara* lange Zeit Normalität. Mit 14 Jahren geriet die heute 20-Jährige in einen rechtsextremen Freund:innenkreis. Fünf Jahre verbrachte sie dort, erst vor einem Jahr gelang ihr der Ausstieg. Aus Angst, erkannt zu werden, bittet sie darum, anonymisiert veröffentlicht zu werden. Clara schämt sich, so lange Teil der rechtsextremen Clique gewesen zu sein. Dabei fing alles ganz harmlos an: in einem Jugendclub im Saale-Orla-Kreis. Dort hört sie zum ersten Mal die Abkürzung NHJ – Neue Hitler Jugend. Im ersten Moment sei sie einfach baff gewesen. Die Hitlerjugend kannte sie nur aus dem Geschichtsunterricht.
Die NHJ habe man schon von weitem erkannt: Bomberjacken, Cargohosen, Stiefel, Seitenscheitel oder Buzz Cut. Der Kerngruppe gehörten etwa fünf Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren an. Mit dem engeren Kreis war Clara zwar nie richtig befreundet, dabei wären sie aber immer gewesen: „Wir waren eine große Gruppe, 20 bis 30 Mann“.
Claras Schilderungen decken sich mit einem Bericht des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena über rechtsextremistische Strukturen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Laut der Analyse sei der Landkreis von einer rechten Jugendszene durchzogen. Es gebe eine aktive rechtsextreme Kampfsport-, Hooligan- und Rechtsrock-Szene. Laut dem IDZ habe sich 2019 in Pößneck die Jugendclique „Neue Hitler Jugend” gegründet. Sie sei durch ihre nationalsozialistische Gesinnung, Schmierereien, Bedrohungen und Übergriffe polizeilich aufgefallen.
Anfangs versuchte Clara die rechtsextremen Kommentare zu ignorieren: „Wenn du nicht darüber gesprochen hast, waren das total nette, liebe Leute“. Irgendwann übernimmt sie ihre Denkweise. Damals sei es cool gewesen, rechts zu sein. „Es war Gruppenzwang“, erinnert sich Clara, „so wie manche mit dem Rauchen angefangen haben, hast du dich irgendwann nicht mehr getraut, etwas gegen rechts zu sagen“.
Es braucht Widerstand
Peers spielen laut Cornelius Helmert eine zentrale Rolle bei der Entwicklung rechtsextremer Einstellungen. Helmert ist Mitarbeiter am IDZ und koordiniert die Demokratieforschung in Thüringen. In Thüringen gebe es laut ihm Hotspots, in denen die Bevölkerung seit Jahren besonders hohe Zustimmungswerte zu rechtsextremen Parteien aufweist. Gera sei einer dieser Brennpunkte. In solchen Regionen würden rechtsextreme Einstellungen in allen gesellschaftlichen Bereichen an Jugendliche weitergegeben: von Eltern, Freund:innen oder der Übungsleiterin im Sportclub. Entscheidend sei laut Helmert, ob es dort eine gesellschaftliche Gegenposition gibt: „In Erfurt oder Jena sehen wir, dass es eine starke zivilgesellschaftliche Mobilisierung gegen rechtsextreme Akteure gibt. Das ist auch für Jugendliche wahrnehmbar. Viel weniger wahrnehmbar ist es in anderen Landkreisen, in denen es oftmals an Widerstand und an einer Positionierung fehlt.“
Auch in Claras Heimat im Saale-Orla-Kreis fehle es an einer Gegenposition. Nicht nur die NHJ hätte die rechtsextremen Einstellungen vertreten: „Das ist über die Generationen hinausgegangen, die Eltern und Geschwister haben genauso gedacht.“
Auf Instagram lichteten sich die Jugendlichen stolz mit Hitlergrüßen und Hakenkreuzen ab. Doch es blieb nicht bei Symbolen. Deutsche und ausländische Jugendliche hätten sich laut Clara regelmäßig zum Prügeln verabredet. Einmal seien bei einer Hausparty auch linke und rechte Jugendliche aufeinandergetroffen: „Da sind Bierflaschen geflogen, einer ist im Busch gelandet.”
Zu Claras damaliger Freund:innnengruppe gehörten auch mehrere Mädchen und sogar einige Jugendliche mit Migrationsgeschichte: „Es gab viele, die keine komplett deutsche Herkunft hatten und trotzdem gesagt haben, alle Ausländer müssen raus“. Diese Jugendlichen seien aber nur so lange Teil der Gruppe, wie die Deutschen es wollten. Sobald es Streit gab, seien sie keine Kumpels mehr gewesen, sondern nur noch die „Kanaken“, erinnert sich Clara.
Das Ausmaß des Rechtsextremismus in der Gruppe sei ihr erst so richtig bewusst geworden, als sie vor einem Jahr nach Jena zog. Dort sei sie zum ersten Mal mit Menschen ins Gespräch gekommen, die eine andere politische Meinung vertraten. Langsam habe sie verstanden, wie schlimm die Zustände in ihrer Heimat tatsächlich waren. Heute steht sie auf der anderen Seite und ist stolz darauf: „’Ne Zecke zu sein ist eigentlich richtig cool“, sagt Clara.
Phine (17)
Eine ganz andere Geschichte über ihre Jugend erzählt die 17-Jährige Phine. Sie geht auf das Otto-Schott-Gymnasium in Jena. In ihrem Jahrgang gebe es kaum rechts eingestellte Schüler:innen. Die Mehrheit ihrer Freund:innen und Mitschüler:innen informiere sich über die politische Situation, engagiere sich beispielsweise im Jugendparlament oder gehe auf Antifa-Demos. Wenn sich dann doch jemand in der Schule homophob oder sexistisch äußert, würden sich die meisten entschieden dagegen stellen. Auch Phines Social Media Algorithmus sei frei von rechten Inhalten. Dass rechte Hetze unter ihren Freund:innen keine Chance hat, liege ihrer Ansicht nach auch daran, dass ihre Eltern ihnen schon Werte vermittelt hätten, die nicht mit denen rechter Parteien übereinstimmen.
Die unterschiedlichen Erfahrungen der vier Jugendlichen zeigen: Das Thema ist zu komplex, um zu pauschalisieren. Von einer Hegemonie rechter Einstellungen unter Jugendlichen zu sprechen, täte vielen Unrecht. Die linken Gegenbewegungen darf man nicht übersehen.
Trotzdem habe sich laut Cornelius Helmert das Wahlverhalten junger Menschen in den letzten Jahren stark verschoben. Bei der Landtagswahl in Thüringen wurde die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen mit deutlichem Abstand die stärkste Kraft. Eine signifikante Zunahme rechtsextremer Einstellungen unter Jugendlichen in Thüringen gebe es laut dem Thüringen-Monitor allerdings nicht. Jugendliche seien laut Helmert aber im Durchschnitt empfänglicher für rechtsextreme Einstellungen geworden. Das schlage sich auch in der Entwicklung einer rechten Subkultur nieder.
Rechtsextreme Jugendkulturen seien laut Johannes Streitberger, Geschäftsführer des Zentrums für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration (KomRex) in Jena kein neues Phänomen. In den 1980er-Jahren habe sich die Skinhead-Bewegung gegründet, bei der Rechtsrock eine zentrale Rolle spielte. Anfang der 2000er-Jahre seien die Autonomen Nationalisten aufgetaucht, die linksradikale Codes und Aktionsformen übernahmen. Die aktuelle Jugendkultur sei laut Streitberger stark durch Social Media und Queerfeindlichkeit geprägt. Außerdem würden rechtsextreme Jugendliche wieder selbstbewusster und offener auftreten, „sei es in den sozialen Medien, im Alltag oder bei Demonstrationen”.
Dieses neue Selbstvertrauen sieht Streitberger als Zeichen für die zunehmende gesellschaftliche Normalisierung rechtsextremer Positionen.
Pandemie und Rechtsruck
Woher kommt es, dass immer mehr Jugendliche offen rechte Einstellungen vertreten? Cornelius Helmert bringt den Rechtsruck mit der Corona-Pandemie in Verbindung und damit, wie die Gesellschaft in dieser Zeit mit Jugendlichen umgegangen ist: “Es wurde sehr viel über sie gesprochen, aber wenig mit ihnen”. Dadurch hätten sich junge Menschen nicht repräsentiert gefühlt und Distanz zur Demokratie aufgebaut. Dieses Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, sei von rechtsextremen Akteur:innen gezielt adressiert worden. Als Björn Höcke vor der Landtagswahl im letzten Jahr einen Simson-Moped-Korso mit 200 Jugendlichen veranstaltete, war die Botschaft deutlich: Schaut her, die AfD interessiert sich für euch. Das Wahlprogramm der AfD spricht zwar kaum jugendpolitische Themen an, doch die Partei schafft es, den Jugendlichen den Eindruck zu vermitteln, gehört zu werden.
Und jetzt?
Laut Helmert seien Teilhabemöglichkeiten wie etwa Jugendparlamente wichtig, um rechtsextremen Einstellungen vorzubeugen. Hier müssten Jugendlichen anstelle von Scheinpartizipation mehr echte Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden.
Für die Prävention an Schulen sind Tages- oder Wochenangebote der Demokratiebildung zu wenig. „Es braucht eine kontinuierliche Arbeit und eine starke Einbindung der Schulsozialarbeit”, sagt Helmert. Lehrer:innen kämen oft kaum gegen die rechten Strukturen an ihren Schulen an. Bei der Mobilen Beratungsstelle für Demokratie und gegen Rechtsextremismus (Mobit) in Erfurt melden sich regelmäßig Lehrkräfte und Eltern, die eine Strategie zum richtigen Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen suchen.
Laut Felix Steiner, Sprecher und Berater von Mobit, sei eine der größten Herausforderungen der Generationenabstand. Zu den neuesten rechtsextremen Trends auf TikTok fehle Lehrer:innen häufig der Zugang. Die Symbolik ist heutzutage nicht mehr so offensichtlich wie in der rechtsextremen Jugendkultur der 90er Jahre. Es sind nicht mehr klassische Zeichen wie der Hitlergruß, sondern teilweise internationale Codes, die in den sozialen Medien verbreitet und erst entschlüsselt werden müssen. Der Zahlencode 1161, der unter zahlreichen rechtsextremen TikTok-Videos zu finden ist, steht zum Beispiel für Anti-Antifa. Der Spruch „Never lose your smile” ist keine Anspielung auf ein Boomer-Wandtattoo, sondern auf den lachenden Totenkopf der SS.
Der Eindruck bestätigt sich – rechte Einstellungen sind bei Jugendlichen wieder im Trend. Social Media hat seinen Teil dazu beigetragen, dass rechtsextreme Einstellungen so sichtbar werden konnten. Mitreißende Reels sind aber nicht die alleinige Ursache dafür, dass Jugendliche immer selbstbewusster rechter werden. Apps wie TikTok verstärken einen Prozess, dessen Ursache woanders gesucht werden muss: im Umgang unserer Gesellschaft mit den Bedürfnissen Jugendlicher.
Catalin Dörmann,
Oleksandra Samokhina
und Lucy Tusche
*Name geändert