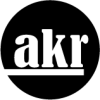Im Jenaer Stadtrat gab es eine Debatte zur Unterbringung von Geflüchteten.
Ist die Stadt überlastet? Wir haben die Betroffenen in Suhl besucht und in Jena nachgefragt. Von Alexandra Kehm

Foto: Johannes Vogt
Fast hatte man das Gefühl, es wäre wieder 2015, als Ende Oktober der Stadtrat über die Situation der Geflüchteten in Jena diskutierte. Der Freistaat Thüringen hatte damals angekündigt, alle Menschen, die ab November hier ankommen, auf die Kommunen zu verteilen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind seit längerem überbelegt, man hat die Chance verpasst, die Kapazitäten zu erweitern. Für Jena hätte das bedeutet, dass jede Woche 30 Geflüchtete in Jena ankommen. Der Stadtrat war deshalb in Aufruhr. Die FDP forderte geschlossene Grenzen, SPD und Linke appellierten an die Solidarität und die AfD äußerte sich mit ihren üblichen rechten Parolen.
Menschen als Zahlen
Am Ende kam es nicht so weit. Das Land hielt sich an die bisherige Verabredung: Nur so viele Geflüchtete schicken, wie Jena unterbringen kann. Aber die Frage bleibt, ob die kommunalen Strukturen überlastet sind? Und wie lässt sich das ändern, ohne Menschenrechte zu missachten? Bastian Stein hat die aktuelle Stunde im Stadtrat angestoßen. Er ist Ex-Bundeswehrsoldat, war unter anderem in Afghanistan stationiert und vor ein paar Jahren noch für die Grünen im Stadtrat – jetzt für die CDU. Die Thüringer Kommunen seien überlastet, erklärt er. Die Kapazitäten könnten sich nie erholen, weil dann schon die nächste Gruppe ankommt. Ressourcen seien dann schon gebunden. Von einer angespannten Lage spricht auch Alexis Taeger, Mitglied der FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat. Er sagt: „Die Flüchtlingskrise von 2015 ist bis heute nicht geschafft.“ Die Kommunen würden auf das Ende ihrer Kapazität zusteuern. Deshalb müsse man die EU-Außengrenzen stärken. Aufgrund der gesunkenen Akzeptanz von Geflüchteten in der Bevölkerung sieht er die Begrenzung der Zuwanderung als einzige Lösung.
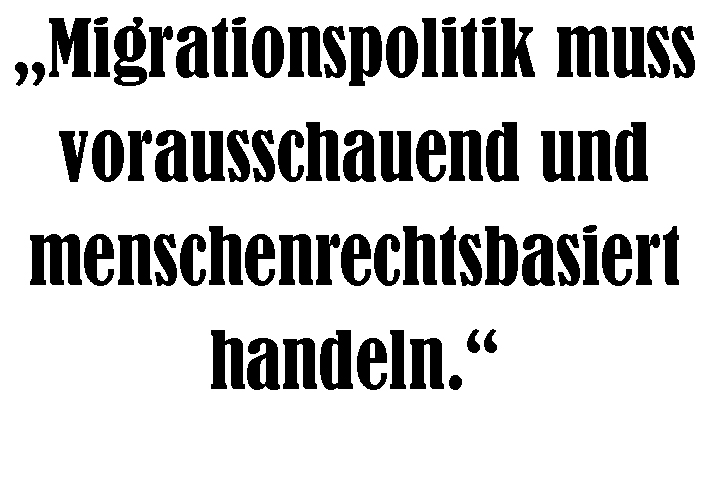
Ein anderes Bild bekommt man von den Stadtratsfraktionen links der Mitte. „Das Budget für die europäische Grenzschutzagentur Frontex ist seit 2004 exponentiell gestiegen, die Flüchtlingszahlen sind aber seitdem nicht zurückgegangen. Das können sie auch nicht, weil die Ursachen nicht beseitigt werden“, sagt zum Beispiel Jörg Vogel von der SPD. Eine Überlastung der Kommunen sieht Vogel nicht. „Das Problem scheint zu sein, dass das Land nicht langfristig plant. Migrationspolitik muss vorausschauend und menschenrechtsbasiert handeln. Es braucht eine konstruktive Zusammenarbeit von Verwaltung, Sozialpartnern und Zivilgesellschaft. Das funktioniert in Jena, aber augenscheinlich nicht in gleichem Maße im Land.“
Ähnlich sieht das auch die Vorsitzende der Linksfraktion, Lena Saniye Güngör. Sie kritisiert, dass Jena weniger Menschen aufnimmt, als es laut Verteilungsschlüssel müsste. Und das, obwohl sich die Stadt als sicherer Hafen bezeichnet. „Es darf hier nicht bei einem Marketing-geeigneten Selbstbild bleiben, sondern wenn wir das ernst meinen, müssen wir das auch umsetzen“, so Güngör.
Sie sieht die Debatte im Stadtrat auch exemplarisch für den gesamt-gesellschaftlichen Diskurs, der gerade zu diesem Thema geführt wird, und fragt, welche gesellschaftliche Wirkung diese haben. Es müsse unterschieden werden, ob man eine Situation als Krise darstellt und verwaltet oder ob es sich um eine Situation handelt, die man mit einer menschlichen Haltung und guter Infrastruktur lösen kann. men deutlich mehr Ausländer:innen nach Jena als in anderen Jahren. Wenn man sich aber die Zahlen für 2023 anschaut, ist kaum ein Anstieg zu sehen. Warum gibt es jetzt diese Debatte?
Der Grund dafür, dass mehr Geflüchtete nach Jena kommen sollen, war ein Aufnahmestopp in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl, dieser wurde am 2. November wieder aufgehoben. Diese zentrale Aufnahme für Geflüchtete des Landes Thüringen hat eigentlich Kapazitäten für 800 Personen, Anfang November waren 1.500 Personen dort untergebracht.

Asyl im Industriegebiet
Um zur größten Erstaufnahmeeinrichtung in Thüringen zu kommen, muss man nicht weit fahren. In Suhl die erste Abfahrt von der Autobahn nehmend, findet man sie am äußersten Stadtrand in einen Industriegebiet neben einem Bestatter und einer Schießsportanlage. Es ist ein grauer Nachmittag. Nebel hängt tief über den umliegenden Bergen und Wäldern, die Temperatur beträgt knapp über null Grad.
Drei graue Wohnblocks, umgeben von einem hohen Zaun mit Drahtabsperrungen obenauf und grüner Sichtschutzplane. Die ehemalige militärische Nutzung des Geländes ist noch gut zu erkennen, die Kinderspielplätze hinter dem Draht wirken fast fehl am Platz. Zugang zum Gelände ist weder ehrenamtlichen Helfer:innen noch Jounalist:innen erlaubt.
Aktivist:innen von Medinetz haben deshalb außerhalb der Anlage einen Stand aufgebaut, sie verteilen Kleiderspenden und sind vor allem hier, um medizinische Probleme mit den Bewohner:innen zu besprechen. In Berichten an die Landesregierung kritisieren sie die medizinische Versorgung in der Erstaufnahme und setzen sich für eine Verbesserung der Verhältnisse ein. Es gibt nur einen Arzt für die 1.500 Bewohner:innen. Viele Menschen würden auch mit akuten Gefährdungen, wie Suizidgedanken oder Problemen in der Schwangerschaft, vom medizinischen Personal in Suhl keine Hilfe erfahren. Auch gebe es keine institutionelle psychologische Betreuung. Ein Angebot macht der Verein Albatros, der mehrsprachig psychosoziale Beratung für Migrant:innen und Geflüchtete anbietet.
Eine der Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl ist Seraj Said, der aus Libyen geflohen ist. Vorgesehen ist, dass Menschen nur einige Tage in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Seraj ist dort jedoch seit zwei Monaten. Er berichtet von wenig Privatsphäre und Diebstählen, weil Türen in der Einrichtung nicht abschließbar seien. Und von einer großen Unsicherheit, da er nicht weiß, wie lange er noch in Suhl sein wird. Er selbst könne damit gut umgehen, er habe einen strukturierten Tagesablauf, arbeitet auch als Dolmetscher für andere Geflüchtete in der Einrichtung. Doch anderen Menschen würde die dauerhafte Ungewissheit Angst machen. In den letzten zwei Monaten war er auch für 14 Tage in Hermsdorf. Dort befindet sich die Einrichtung für Geflüchtete in einer großen Lagerhalle, Stockbetten sind nur durch Bauzäune und Planen voneinander getrennt. Nach diesen zwei Wochen in Hermsdorf hätte es Streit unter den Geflüchteten gegeben und ein Teil der Geflüchteten ging wieder zurück nach Suhl. Er sagt aber auch, dass er und viele andere Leute dankbar seien, es gebe warmes Wasser und Deutschland sei ein gutes Land. Wenn man die Anlage in Suhl von außen betrachtet, fällt es schwer, das zu glauben.