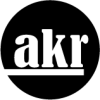Die Polizei übernimmt oft die Rolle von Sozialarbeiter:innen. Eigentlich will sie helfen. Trotzdem ist das ein Problem. Wir haben zwei Polizisten auf einer Schicht begleitet. Von Götz Wagner.

„Jetzt liegt es an uns“, sagt der Polizist am Steuer. Er fährt den Streifenwagen an einem Spielplatz in Winzerla vorbei – drei Jungs, vielleicht 12 Jahre alt, spielen an den Kletterstangen. „Spielplätze sind beliebte Drogenumschlagplätze“, sagt er. Die ganze Situation sei ihm nicht geheuer.
Das Polizeiaufgabengesetz erlaubt der Polizei, überall dort Identitäten festzustellen, wo Straftaten verübt werden könnten. Dafür braucht es tatsächliche Anhaltspunkte. Der Polizist am Steuer sagt, dass sein Bauchgefühl entscheidet, ob er kontrolliert oder nicht. Er fährt weiter. Die Polizei leidet unter akutem Personalmangel. Nach Angaben der Polizeigewerkschaft GdP sind bundesweit 20.000 Stellen unbesetzt. Ihre Streifen führen sie deshalb eher zu den Brennpunkten: Paradiespark, Lobeda, Winzerla. Es sei aber ein Trugschluss, dass an anderen Orten in Jena keine Straftaten begangen würden.
er Streifenwagen fährt unter dem Paradiesbahnhof hindurch und biegt vor der Saale rechts auf den Fußgängerweg ab. Es ist ein kalter, regnerischer Sommerabend. Davon lässt sich eine Gruppe Jugendlicher die Nacht aber nicht vermiesen. Ein Mädchen aus der Gruppe rennt durch das nasse Gras auf das fahrende Polizeiauto zu. Sie lacht. Der Beamte am Steuer hält und macht das Fenster auf. „Dich kennen wir doch!“ Das Mädchen spricht den Polizisten an, als wäre er ein alter, väterlicher Freund. Kennengelernt hätten sie sich, als er sie und ihre Freund:innen im Paradies kontrolliert habe. Seitdem sehen sie sich immer im Park, wenn die Streife vorbeikommt. Sie erzählt dem Polizisten aus ihrem Leben, wie sie die Schule geschwänzt und Kippen geraucht hat. „Das lässt du schön bleiben! Glaub mir, Schule ist das Wichtigste.“ Das Mädchen nickt und verspricht, sich zu bessern.
Ein ungutes Gefühl
Solche Dinge passieren an diesem Abend oft: Die Beamt:innen kontrollieren Minderjährige, ermahnen, wenn diese Zigaretten und Bier haben, filzen auf Drogen – „dann brennt die Luft!“ Danach fragen sie, wie es in der Schule laufe oder wie es der Mutter ergehe. Die Polizeibeamt:innen kennen die Kinder, die sie kontrollieren, und ihre Familien. Und die Kinder schütten den Polizist:innen ihr Herz aus.
Die Landespolizeiinspektion will nicht verraten, wie oft sie Autos auf Streife schickt. Die Zahlen seien Interna. Wer einmal im Sommer eine Limo auf der großen Wiese getrunken hat, weiß aber, dass man regelmäßig von einer Streife umfahren wird. „Präsenzstreifen sollen für den Bürger ansprechbar sein und ein Sicherheitsgefühl vermitteln“, sagt ein Polizist. Das ist der Anspruch. Dass das nicht alle Bürger – wie sie sagen – so sehen, das wüssten die Beamten.
Polizist:innen sehen während ihrer Arbeit viel Elend. Es breche einem das Herz, wenn man beobachten müsse, wie nach der Reihe alle Söhne einer Familie in die Drogenabhängigkeit abrutschen. Streifenpolizist:innen wollen auch als Ansprechpersonen gelten, nicht nur den Bad Cop spielen.„Man hat das Gefühl, das ist eine gute Sache“, sagt Sören Kliem, Professor für Theorie der Sozialen Arbeit von der Ernst-Abbe-Hochschule. Die Polizei habe immer wieder die Idee, sozialarbeiterische Aufgaben zu übernehmen. Das sei auch institutionalisiert, wie Präventionsprogramme in Schulen zeigten. Es gibt auch sogenannte Kontaktbereichsbeamt:innen, die direkt im Stadtteil für die Probleme des kleinen Mannes da sein sollen. „Die Polizei erweitert damit ihren Aufgabenbereich und entfernt sich von ihrer Kernkompetenz“, also der Bekämpfung und Aufklärung von Kriminalität. Polizei und Sozialarbeit haben zwar Berührungspunkte. Sie arbeiten häufig in einem ähnlichen Ausschnitt der Gesellschaft.
Doch die Polizei sei für andere Aufgaben schlichtweg nicht ausgebildet. „Wenn Sie Ihr Schloss nicht aufbekommen, weil Sie Ihren Schlüssel verloren haben, dann rufen Sie auch jemanden, der das Schloss aufmachen kann. Sie können auch alternativ die Feuerwehr rufen, aber die tritt Ihnen dann die Tür ein.“ Soziale Arbeit und Polizei hätten grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen an Bedrohungslagen. Ausgebildete psychosoziale Fachkräfte stellen Abstand her, bringen Umstehende in Sicherheit, beruhigen und lassen der Person möglichst viel Raum zum Auspendeln ihres Erregungszustandes. Polizist:innen umstellen eher, schreien, versuchen, über ihre eigene Bedrohlichkeit das Gefahrenpotential der Person zu ersticken, und machen im Zweifel von der Waffe gebrauch. So eskalierten Situationen besonders dann, wenn das Gegenüber auf Grund seiner psychischen Erregung auf die Bedrohung der Polizei gar nicht oder nur eskalativ reagieren kann. Die Beamt:innen seien in den meisten Fällen einfach überfordert.
Zwang und Vertrauen
Für die Sozialarbeit zählt das Prinzip des guten Grundes. Menschen seien in ihren Lebenssituationen auf Grund spezifischer Entscheidungen und Prozesse, die für sie auch eine Art Rationalität in sich tragen. Die Polizei habe immer nur kurzfristige Lösungen zu bieten. „Niemandem hilft es, den Alkoholkranken einzusperren; der trinkt am nächsten Tag weiter.“ Stattdessen brauche es Hilfe zur langfristigen Selbsthilfe und echte gesellschaftliche Teilhabe grade für die Menschen, die aktuell aus der Normgesellschaft herausgedrängt werden.
Und dafür braucht es Vertrauen. Und das kann die Polizei nicht wirklich gewährleisten. Ein Polizist sagt: „Wenn ich eine Straftat sehe, kann ich nicht gegenüber dem Gesetzgeber sagen: Das verfolge ich nicht.“ Gerade dann, wenn sie als vermeintlicher Freund und Helfer auftrete, bekommt Repression schnell neue Wege, um zu wirken. Polizist:innen könnten so zum Beispiel ihre Bürgernähe ausnutzen, um das Recht der Unverletzbarkeit der Wohnung zu umgehen.
Im schlimmsten Fall müssen Menschen mit akuten Problemen durch den Strafverfolgungszwang dann strafrechtliche Konsequenzen fürchten. Viele Menschen rufen deshalb nie die Polizei. Sie sei ein Stressfaktor, so Kliem. Man wisse auch aus der Forschung, dass Polizist:innen an Schulen überproportional BIPoC-Schüler:innen ins Visier nehmen.
Durch Racial-Profiling würden junge Menschen bereits früh und wegen Bagatellen in den Kontakt mit dem Strafjustizsystem kommen. Solche Kontakte seien für die Prognose künftiger Rechtstreue eher kontraproduktiv.
„Es gibt zu wenige Jugendzentren in Jena, und die haben gerade an den Wochenenden nicht auf,“ sagt der Polizist am Steuer. Deshalb würden alle Jugendlichen, die sich benehmen würden, und die, die es nicht könnten, an denselben Orten sein. „Es ist nicht die Aufgabe der Polizei, zu beurteilen, ob sich Jugendliche adäquat verhalten.“ Abweichendes und normbrechendes Verhalten sei ein elementarer Bestandteil jugendlicher Entwicklung. Keine Pubertät komme entwicklungspsychologisch ohne das Überschreiten von Grenzen aus. Nicht vor 100 Jahren, nicht vor 50 Jahren und heute auch nicht, sagt Kliem.„Man könnte auch bei der Polizei sparen und mit dem Geld Sozialarbeit finanzieren.“ Dann könne man sagen: „Wir brauchen die Polizei nur an ganz wenigen Stellen und sie kann sich mit ihren Ressourcen besser auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, statt eine Art gesellschaftlicher Feuerwehr spielen zu müssen.“