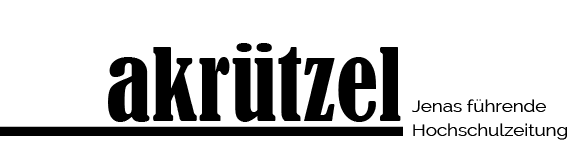Das vermeintlich gute Gewissen liegt nicht immer auf der Straße
Von Maria Hoffmann und Maximilian Gertler
Und siehe, da war einer, der kam auf einem Fahrrad daher. Gut sichtbar schrieb er seine Botschaften in großen Lettern auf Tafeln und stellte sich auf den weiten Platz. Er sprach zu den Menschen mit großen Gebärden und lauter Stimme. Da runzelten sie die Stirn und gingen ihres Weges. Aber wer doch stehen blieb wurde bedacht mit Worten und Weissagungen alter Art. Einige nahmen sich der Botschaften an, andere verspotteten ihn. So trug es sich zu. Alle Tage und Sisyphos gleich, wurde er nicht müde zu predigen.
Der Mann mit dem voll beladenen Fahrrad steht oft auf dem Campus und wird den meisten Studenten zumindest von Weitem bereits aufgefallen sein. „Jesus rettet!“ verkündet ein Schild, das stets an seinem Fahrrad befestigt ist. Offensiv und mit lauten Predigten versucht er, zu den Passanten durchzudringen. Ob es ihm mit seiner Art gelingt, ist fraglich. Die Meisten mustern ihn mit Argwohn. Seine Botschaft über Jesus und das Christentum ist dabei nicht die leichteste Kost. „Diese Methode ist heute doch eher ungeeignet. Davon halte ich nicht viel“, sagt Uwe Kaul von der Jenaer Pfingstgemeinde. Er hat den christlichen Kollegen beobachtet und ist schon mit ihm ins Gespräch gekommen. „Wenn er dann anfängt und Gedichte rezitiert, wirkt das irgendwie unecht.“ Die Menschen seien heutzutage an Authentizität interessiert und würden sich davon wahrscheinlich mehr abgestoßen fühlen, als dass die Botschaft Jesu sie erreiche. Kaul ist Pastor und baut einige Male im Jahr seinen Stand in der Jenaer Innenstadt auf. Auch an manchen Herbsttagen steht er hier vier bis fünf Stunden. Er hat sich dafür den hinteren Eingang zur Goethe-Galerie ausgesucht. „Hier ist es etwas ruhiger und die Leute nehmen sich eher Zeit für ein Gespräch“, erzählt er.
Der Tisch der Pfingstgemeinde liegt voll mit Prospekten, Büchern und DVDs: „Alles kostenlos zum Mitnehmen.“ Auf der bunt gemusterten Tischdecke finden sich Jugendzeitschriften mit Themen, die ihnen einen modernen Anstrich geben sollen, Drucksachen, die Fragen aufwerfen wie: „Heilt Gott heute noch?“ und sich mit dem Fußballgott auseinandersetzen. Von sich aus würde Kaul niemanden einfach so ansprechen, der an seinem Stand vorbeigeht. „Der erste Kontakt geht eigentlich von den Passanten aus“, erklärt er seine eher passive Art, die christliche Botschaft zu verbreiten. Als Missionar würde er sich auf keinen Fall verstehen, vielmehr als engagierter Christ, der am täglichen Leben der Menschen interessiert ist. Ob das tägliche Leben der Jenaer nicht bloß an ihm vorbeizieht, bleibt fraglich. Der Andrang sei recht unterschiedlich, aber die Massen reißen ihm seine Prospekte natürlich nicht vom Tisch, sagt er.
In gemütlicher Runde, bei Bier und grünem Tee, trifft sich einmal pro Woche der studentische Bibelstammtisch, organisiert von der Gruppe Connexxion. Auch Nicht-Christen sind eingeladen, die Bibel zu diskutieren. „Unser Hauptanliegen ist der Dialog mit den Studierenden, egal ob gläubig oder nicht. Wir wollen die Bibel auch selber prüfen und kritische Fragen an den Text stellen“, sagt Thomas, der diesen Stammtisch als ein Angebot für Bibelinteressierte begreift. So wird mit einer Fragerunde über wahre Reue gestartet und über den raubeinigen Täufer Johannes gesprochen, der die Pharisäer im Feuer brennen sehen wollte.
Wirklich missioniert wird hier nicht. „Ohne eigene Erfahrung kann man sowieso niemanden vollends überzeugen“, meint Antje, Leiterin des Stammtisches. Das solle nicht heißen, jeder müsse ein Gotteserlebnis gehabt haben. Aber die innere Einstellung sei es, die den Glauben ausmacht. Obwohl sie, wie sie sagen, niemandem etwas aufdrängen wollen, zeigen sich die Stammtischteilnehmer überzeugungsfreudig. Nach dem offiziellen Schluss der Runde argumentieren sie mit allerlei modernen Gleichnissen für die Existenz eines christlichen Gottes. Da sie daran fest glauben, bleibt die Diskussion letztendlich eher einseitig. Offenheit für Nicht-Gläubige ja, aber diese findet, wenn, dann nur in eine Richtung statt.
Missionieren: Impossible
Missionieren im Sinne des unbedingten Verbreitungswillens scheint den religiösen Gruppen an der Uni fernzuliegen. Sabine Nagel, Studierendenpfarrerin der FSU, sieht das ähnlich: „Der Inhalt der christlichen Botschaft und die Methoden der Verkündung müssen sich entsprechen.“ Manipulation und die Verbreitung des Glaubens mit Druck ließen sich mit der Lebenspraxis Jesu einfach nicht vereinbaren. „Das sehe ich nicht nur mit Blick auf die Geschichte der Christenheit so“, fügt sie dem hinzu. Mit öffentlichen Predigern und Schilder tragenden Botschaftern kann Nagel nichts anfangen. Sie empfindet dieses Verhalten als bedrängend und sieht die „Achtung der Würde des Anderen“ in Gefahr. Dennoch sei Öffentlichkeitsarbeit wichtig. „Werbung im üblichen Sinn, Veröffentlichung der Angebote und Inhalte, finde ich angesichts der Fülle an Angeboten auch notwendig.“ Interessierte sollen zugreifen können, um den ersten Schritt von sich aus zu machen. Allerdings plädiert Nagel dafür, dass niemand die sprichwörtliche Katze im Sack angeboten bekommt: „Es sollte drin sein, was drauf steht. Kein locker-flapsiges Etikett mit engem Inhalt.“
Es hat mehr den Anschein, als verstünden sich die Religionen zunehmend als offene Angebote, die die Freiheitsliebe unserer Gesellschaft nicht einschränken möchten und befürchten, für zu starke Präsenz abgestraft zu werden. Auf keinen Fall möchten sie mit aufdringlichen Türklinglern oder lauten Missionaren in Verbindung gebracht werden. Eine noch relativ junge Religion nimmt sich diesem Prinzip besonders an. Die Bahai, zurückgehend auf die Schriften ihres Religionsgründers Baha‘u‘llah, entstand im 19. Jahrhundert. In Jena umfasst die Gemeinschaft im Moment neun Mitglieder. „Vor fünf bis sechs Jahren waren es noch über 20 Bahai“, erläutert Tobias Vetter, Vorsitzender der Hochschulgruppe. Dass es so wenige sind, hänge auch mit der Fluktuation am Uni-Standort zusammen. Allerdings setzen die Bahai auch wenig auf öffentlichkeitswirksame Methoden, um sich bekannt zu machen. Ihre Botschaften über die starke Akzeptanz der Wissenschaft und die Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen sollten unter sinnsuchenden Studenten auf fruchtbaren Boden fallen, könnte man meinen.
Die Religion selbst hält nicht viel vom Missionieren. Den Glauben aufdringlich anpreisen oder von Tür zu Tür tragen würden Bahai vermeiden, heißt es. „Das ist in den Bahai-Schriften verboten und würde auch in den Gemeinden keinen Anklang finden“, meint Tobias. Wie steht es da um Öffentlichkeitsarbeit? Immerhin gebe es eine Internetseite, sagt er. Aber mit Tischen in die Innenstadt gestellt hätten sich die Bahai schon seit Jahren nicht mehr: „So ein Stand wirkt nur irgendwie aufgesetzt, dadurch, dass er das soziale Umfeld des Gemeindemitglieds verlässt.“ Denn den Bahai wird nahegelegt, lediglich in ihrem persönlichen Umfeld über die Religion zu sprechen. Kommt das Gespräch auf das Thema, erzählt Tobias über seinen Glauben. Wirklich öffentliche Auftritte seien da doch eher mit menschenrechtlichen Aufrufen verbunden, denn die Bahai werden im Iran beispielsweise noch immer unterdrückt.
Moderner Ablasshandel
Beim heutigen Überangebot an Botschaften, Weltanschauungen und Heilsversprechen und einem schwindenden Interesse an den beiden großen Kirchen könnten knackige Slogans vielleicht helfen, die gewünschte Aufmerksamkeit zu erzielen. Den Einsatz für Notleidende und Entrechtete in aller Welt haben im neuen Jahrtausend große Organisationen wie Amnesty International und das Rote Kreuz öffentlichkeitswirksam gestaltet. Sollen Botschaften heute Gehör finden, setzen viele Organisationen auf aufmerksamkeitserregende Methoden. NGOs wie Amnesty International, Unicef und Aktion Tier bauen ihre bunten Stände in deutsche Innenstädten auf und lassen sich von Personalagenturen meist extrovertierte Studenten zur Seite stellen.
Im Kampf um Aufmerksamkeit für den vermeintlich guten Zweck arbeiten sie zehn Stunden täglich, sechs Tage am Stück, wie Ulrike, Jenaer Studentin, erzählt. Sie ist Fundraiserin und sammelt Spenden für Amnesty International. Wer neu anfängt, darf sich drei Wochen hintereinander die bunte Jacke anziehen und stets gut gelaunt auf Passanten zugehen. „Die Organisationen wollen herausfinden, ob man stetig mitmachen kann und nicht nur ein One-Hit-Wonder ist“, erklärt sie. Ulrike hat den Job zunächst angefangen, um sich im Sommer Geld dazuzuverdienen. Mittlerweile, so sagt sie, mache sie es auch einfach, weil es Spaß mache und sie etwas Gutes tue.
Bevor sie ihren Einsatz auf der Straße beginnen konnte, hat Ulrike an einem mehrstufigen Auswahlverfahren teilgenommen, bei dem ihre kommunikativen Fähigkeiten getesÂtet wurden. „Da wird einfach geguckt, ob man reden kann, eine gewisse Ausstrahlung hat, und ob man überhaupt der Typ dafür ist, Leute auf der Straße anzusprechen.“ Die Agentur, von der Ulrike schließlich eingestellt wurde, ist eine der marktführenden in Deutschland und heißt Dialog-direkt. Geschult werden die Fundraiser nicht nur inhaltlich von Mitgliedern der Organisation, sondern auch von Psychologen. „Dort wurde uns dann auch gesagt: Passt auf, bestimmte Wörter sagt ihr lieber nicht, denn die implizieren etwas Negatives bei den Passanten.“ Zu diesen Wörtern gehören zum Beispiel „kündigen“ oder „Vertrag“. Eine kommunikative Feinheit, an der lange geübt wird. Natürlich sei klar, dass es sich um einen Vertrag handle, wenn Spenden von den Vorübergehenden erbeten werden und sie ein entsprechendes Dokument unterzeichnen. Dennoch sei es wichtig klarzustellen, dass die Spender jederzeit die Möglichkeit hätten, ihr Spenderverhältnis aufzulösen oder rückgängig zu machen. „Es ist kein Unterschriftenhaschen, sondern vielmehr ein In-die-richtige-Richtung-Schubsen“, sagt Ulrike. Natürlich würden die Meisten einfach vorbei gehen, aber die, die stehen bleiben, seien auch davon überzeugt. Sich den Leuten in den Weg zu stellen, sei bei ihrer Agentur strengstens untersagt. Bei anderen Organisationen habe sie diese Methoden aber durchaus schon gesehen.
Präsenz zeigen, in den Köpfen der Menschen bleiben, das seien die wichtigsten Dinge und darum würden diese Stände in den Einkaufsstraßen aufgebaut. Abseits der Tagesschau müsse weiter darauf aufmerksam gemacht werden, welche Dinge sich in der Welt zutragen. Dass es Flüchtlinge in 160 Ländern der Erde gebe und eben nicht nur das gerade aktuelle Einzelbeispiel kurz verfolgt werde. Ob die Organisationen noch mehr Spender über ihre Stände bekommen würden, wenn sie auf schockierende Plakate setzen würden, bezweifelt Ulrike: „Klar bringen solche Bilder Leute zum Stehenbleiben. Es ist aber nicht Sinn der Sache, dass die Leute spontan aus bloßem Mitleid, sondern dauerhaft mitmachen.“ Es gelte, die Botschaft dauerhaft in den Köpfen der Menschen zu verankern.
Auf der modernen Suche nach dem Seelenheil scheinen irdische Heilsbringer effektiver Lösungen anzubieten. Kann man aber für Glauben überhaupt Werbung machen? Religion im neuen Jahrtausend ist und bleibt der private Weg zum guten Gewissen.