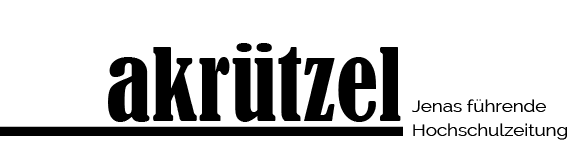Auch unter Studenten nehmen Depressionen zu
Von Jana Felgenhauer und Jan-Henrik Wiebe
 |
|
Jeder fünfte Deutsche leidet in seinem Leben mindestens ein Mal unter Depressionen Foto: Katharina Schmidt |
Die Hoffnungslosigkeit fährt Straßenbahn. Sie spaziert im Park, liegt bei 35 Grad am Schleichersee, sie geht abends in die Rose und am nächsten Morgen sitzt sie mit im Vorlesungssaal. Sie begleitet den Betroffenen wie ein kalter, unsichtbarer Lufthauch, ist allgegenwärtig und weil sie sich so hartnäckig an ihn heftet, wird sie für den Kranken zu einem unerträglichen Zustand.
Depression, eine Krankheit, die jeder bekommen kann und deren Gründe vielfältig sind. Genetische Ursachen, Stoffwechselstörungen, Hirnschädigungen, vor allem aber biografische und soziale Faktoren können dabei eine Rolle spielen. Bei Depressionen wirken meistens innere und äußere Umstände zusammen. Oft ist ein geringes Selbstwertgefühl, das durch einen frühkindlichen Konflikt entstanden sein kann, der Auslöser für spätere psychische Störungen. Das seelische Gleichgewicht eines Menschen ist stark abhängig von Ereignissen und Konflikten, die auf ihn zukommen und die es zu bewältigen gilt. Schicksalsschläge wie der Verlust eines Angehörigen, das Ende einer Liebesbeziehung; soziale Probleme, zu denen Leistungsdruck, Angstzustände und Einsamkeit zählen; neurotische Störungen oder auch Drogenabhängigkeit. Sie alle können die Krankheit begünstigen. Angesichts dieser vielfältigen Ursachen ist es nicht überraschend, dass laut der deutschen Depressionshilfe hierzulande jeder fünfte in seinem Leben einmal an einer Depression erkrankt.
Inneres Ungleichgewicht
„Depression“ ist ein Überbegriff, bei dem es dennoch Kernsymptome gibt, die auf viele Varianten der Krankheit zutreffen. Dazu zählen Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, Minderwertigkeitsgefühle und Grübeln über Lebensereignisse ebenso wie Antriebsmangel, Appetitlosigkeit oder gerade vermehrter Appetit und eine Suizidalität, bei der der Patient davon ausgeht, er wäre „besser tot als ständig so hoffnungslos“ zu sein. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes sind Depressionen in Europa tödlicher als Aids, Drogenmissbrauch und Verkehrsunfälle zusammen. Das liegt allerdings nicht allein an den hohen Suizidraten, sondern auch an den mit Depressionen verbundenen Folgekrankheiten wie Diabetes II, Schlaganfälle und Herzinfarkte. Oft sind Betroffene nicht mehr in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen, geschweige denn, einer Arbeit oder einem Studium nachzugehen. Je nach Schweregrad der Depression sind die Patienten darauf angewiesen, dass äußere Einflüsse das innere Gleichgewicht stabil halten. Bei einer leichten Depression reichen da schon Erfolgserlebnisse und Zuspruch von anderen Menschen. Ist sie schwerwiegender, sind Psychotherapie, Medikamente oder auch ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik notwendig. Sobald Stabilisatoren wegfallen, kann die Gemütslage des Betroffenen allerdings wieder außer Kontrolle geraten. In seltenen Fällen wird bei schwerer Depression auch die Elektroschocktherapie angewendet.
Erfolg schützt nicht vor Depression
Dass Depressionen jeden treffen können, wird an vielen Persönlichkeiten deutlich, die auch von der Krankheit betroffen waren oder sind. Frau Dr. Risch von der „Ambulanz für Forschung und Lehre“ am Institut für Psychologie der Universität Jena erklärt, dass es depressiven Menschen sogar helfen kann zu wissen, dass auch erfolgreiche, vermeintlich glückliche Personen an derselben Krankheit leiden können. Die Liste reicht von Abraham Lincoln, Ernest Hemingway, Vincent van Gogh, Lew Tolstoi und Franz Kafka zum deutschen Fußballer Sebastian Deisler, der das Thema Depression im Profisport zum ersten Mal an die Öffentlichkeit brachte. Deisler ging mit seiner Depression offen um und trug damit auch ein wenig zur Entstigmatisierung der Krankheit bei. Er musste auf Grund von Depressionen seine Karriere beenden. Tragisch endete hingegen das Leben von Fußballnationaltorwart Robert Enke, der in Jena geboren wurde. Zusammen mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga hat Hannover 96 nach dessen Suizid im Jahr 2009 die Robert-Enke-Stiftung gegründet. Ziel ist die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, die über die Krankheit Depression aufklären und sie erforschen. Auf Grund der großen Medienberichterstattung über den tragischen Vorfall gab es viele Nachahmer. Wissenschaftler sprechen in dem Zusammenhang vom „Werther-Effekt“, welcher nach der Veröffentlichung von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ auftrat. Besonders junge Menschen, die sich mit der Figur Werther und seiner Geschichte identifizierten, versuchten sein Handeln nachzuahmen, was sich in zahlreichen Suiziden und Selbstmordversuchen äußerte. Dies brachte eine Diskussion über Medienwirkung in Gang, die auch heute wieder geführt wird.
Depressionen im Studienalltag
Studien haben ergeben, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen besonders häufig in Lebensphasen mit gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen auftreten, wie es beim Studium der Fall ist. Studenten sind keine Jugendlichen mehr, gehören aber auch noch nicht in die Gruppe der Erwachsenen. Sie befinden sich in einer Zwischenphase, in der sie auf sich allein gestellt sind, zusätzlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen müssen oder vielleicht noch finanziell von den Eltern abhängig sind. In dieser Phase sollen sie den Anforderungen des Studiums gerecht werden, sich ein neues soziales Umfeld aufbauen, mit offenen und unsicheren Zukunftsperspektiven abfinden und mit einem hohen Erwartungsdruck in Bezug auf berufliche Entscheidungen leben. Je länger diese Übergangssituation dauert, desto mehr Spielraum bleibt für Krisen und Konflikte. Eine Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hat hervorgebracht, dass vor allem Leistungsprobleme, mangelndes Selbstwertgefühl, depressive Verstimmungen, Prüfungs- und allgemeine Ängste zu den am meisten verbreiteten psychischen Beeinträchtigungen während des Studiums zählen. Auch die Identitätsentwicklung spielt eine entscheidende Rolle. An einer Universität mit 21.400 Studierenden wird das Gefühl einer individuellen Einmaligkeit erschüttert und viele Studenten quälen sich mit der Frage „was unterscheidet mich eigentlich von allen anderen?“
„Traurig ist jeder mal“
Psychologische Hilfe kann jeder kostenlos in Anspruch nehmen. Die Lage von Depressiven beschreibt Risch von der Ambulanz der FSU als keineswegs ausweglos. Die Ambulanz der Friedrich-Schiller-Universität bietet eine Beratungsmöglichkeit für Menschen mit psychischen Problemen. Weitere Anlaufstellen sind die Psychosoziale Beratung des Studentenwerks sowie der Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena. Damit es gar nicht so weit kommt, empfiehlt Frau Dr. Risch den Studenten ein ausgewogenes Leben zu führen. „Gerade unter den Studierenden lernintensiver Fächer gibt es einen hohen Leistungsanspruch und ausgeprägten Perfektionismus.“ Dies kann nicht immer gut gehen.„Sport ist ein sehr guter Ausgleich“, so die Psychologin. Ein starkes soziales Netzwerk ist genauso wichtig. „Wenn über zwei Wochen die Symptome einer Depression vorhanden sind, sollte eine Beratungsstelle aufgesucht werden, denn ab dann spricht man von einer Depression, die kann vorübergehen, aber auch irgendwann wiederkommen, wenn sie nicht behandelt wird“, sagt Risch. Der Expertin zufolge kehren bei 40% der Betroffenen nach zwei Jahren die Symptome der Krankheit wieder. Wer sich ein paar Tage lang nicht gut fühlt, muss sich hingegen noch keine Sorgen machen, depressiv zu sein. „Schlechte Stimmung hat jeder einmal, das ist normal. Eine richtige Depression kann bis zu einem halben Jahr dauern“, sagt die Psychotherapeutin.
Erste Hilfe bei Problemen
Als niedrigschwelliges Angebot versteht sich die „Campus Couch“, ein Projekt von Psychologiestudenten, das sich an alle Studierenden mit Problemen richtet. Nach Kontaktaufnahme per E-Mail bieten sie zeitnah Gespräche an, in denen die Betroffenen offen und vertraulich über alles reden können. Die Person kann bestimmen, wann und wo sie sich treffen möchte. Dabei beschränken sich die Psychologiestudenten auf neutrales Zuhören, ohne Ratschläge zu geben oder das Erzählte zu werten. Laut Campus Couch-Gründer Nils hat der Hilfesuchende so die Möglichkeit sein Problem auch für sich noch einmal zu reflektieren, da er die Geschichte von Anfang an erzählen und für sich selbst strukturieren muss. Sich auf der „Campus Couch niederlegen“ bedeutet aber nicht, eine Psychotherapie zu machen. Schließlich sind die Studenten keine ausgebildeten Therapeuten. Sollten sie bemerken, dass die Person in einer schwerwiegenderen Lebenskrise steckt, könnten sie diese entweder an die psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks oder den sozialpsychiatrischen Dienst verweisen. „Wir bieten keine Therapie an und eine Diagnose stellen wir auch nicht. Es soll einfach ein Stückchen selbstverständlicher werden sich mit sich selbst auseinander zu setzen“, beschreibt Nils das Projekt. Ziel sei auch die Entstigmatisierung von Hilfesuchenden.