Eine studentische Biografie im Zeichen der Depression
Von Christian Fleige
„Wie alles angefangen hat?“, wiederholt Lukas* die ihm gestellte Frage und zögert einen Moment, bevor er schließlich antwortet: „Ich war damals noch sehr jung und ging zur Grundschule. Eines Abends lag ich im Bett. Es war ein normaler, es schien ein normaler Tag gewesen zu sein. Aus dem Nichts zog damals dieser Gedanke auf: ‚Du musst sterben – vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber du wirst sterben.‘ Mein Herz überschlug sich und ich geriet in Bewegung. Ich stürzte aus meinem Kinderzimmer durch den Flur ins Wohnzimmer, wo meine Eltern noch fernsahen, rannte getrieben von der Furcht Runde um Runde um den Wohnzimmertisch, bis mich mein Vater zu fassen bekam. Körperlich stand ich still, innerlich rotierte ich mit maximaler Leistung um den einen Fixpunkt. Tage und Nächte lang. Ein normales Leben war nicht möglich.“ Die Erinnerung an den Beginn einer Krankheit.
Lukas war depressiv, phasenweise, zusammen mit Angst-, öfter auch Essstörungen. Im Laufe seines Lebens immer mal wieder, auch während des Studiums an der Friedrich-Schiller-Universität. Vier Therapien liegen heute hinter ihm, eine davon brach er ab.
Lukas selbst bezeichnet sich als einen eher ängstlichen Typ, der sich zuweilen ausufernde Gedanken macht, wo andere ganz beiläufig eine Entscheidung treffen. Einfache Aufgaben können zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Anstatt die Sache einfach anzugehen, analysiert er sie und verliert sich in ihrer Komplexität, weicht eingeschüchtert zurück. Bei ihm herrscht ein krasses Anspruchsdenken vor, ein Streben nach Perfektion, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ein Einsiedlerdasein fristet Lukas jedoch nicht. Er spricht von einem geringen Selbstbewusstsein in guten Phasen und von einem nicht existenten zu Zeiten seiner Depressionen. Er schluckt drei verschiedene Medikamente am Tag: Lithium, um sein System im Gleichgewicht zu halten, um zu heftige Stimmungsschwankungen zu vermeiden. Mirtazipin, um Schlaf zu finden und L-Thyroxin gegen eine Schilddrüsenunterfunktion, die höchstwahrscheinlich von Medikament Nummer eins verursacht wird.
Zur ersten Therapie bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin kam es spät. Doch am Ende der neunten Klasse waren die Zustände für alle Beteiligten unerträglich. Lukas schlief nicht mehr, er aß nicht mehr, er ging nicht mehr vor die Tür und hielt auch seine Eltern auf Trab, wandte er sich mit seiner Angst doch an sie – auch nachts. Dann erzählte er ihnen von Sinnlosigkeit, AIDS und BSE. In den Jahren zuvor hatte kein angerufener Arzt verstanden, was in Lukas vorging. Und die Eltern spielten die Symptome herunter: „Du brauchst doch keine Angst zu haben“ und „Warum kannst du denn nicht schlafen?“ Hilflos wiederholte Phrasen, die verhallten. „Einen Vorwurf kann man meinen Eltern nicht machen, denn sie wussten es nicht besser. Woher auch?“, sagt Lukas über ihr Verhalten. Seine Großeltern und der Rest der Familie erfuhren nichts. Aus Angst vor übertriebener Sorge und Unverständnis, vielleicht auch aus Scham. Auch seinen Freunden gegenüber schwieg er, das oft wochenlange Versteckspiel wurde mit Ausflüchten kaschiert. Irgendwann war dann auch die erste Gesprächstherapie vorbei und Lukas startete stabil in die Oberstufe, ohne grundsätzlich verstanden zu haben, was mit ihm passierte, wenn die für Außenstehende völlig irrationale Angst, die aus Lukas‘ Perspektive stets rational anmutete, über ihn hereinbrach. Damals war es ihm auch egal, doch die Angst vor der Angst war sein stiller Begleiter.
Das Abitur bestand er dann souverän, doch mit Beginn des Zivildienstes kamen die Ängste wieder auf und machten die Ausübung des Gärtnerjobs in einer Behindertenwerkstatt unmöglich. „Bei diesem Rückfall gab es Wochen, in denen ich fast gar nichts gegessen habe. Vielleicht mal ein Stück Apfelkuchen, mehr nicht. Auch die Hygiene litt, meine kaputten Zähne zeugen davon. Ich drehte mich gedanklich wie blöde um den unausweichlichen Tod und erstarrte dabei gänzlich. Vielleicht griff ich in meiner Not noch zu esoterischem Klumpatsch, aber der half mir auch nicht weiter. Ich war wieder mal in meiner Angst gefangen“, erzählt Lukas von der zweiten großen depressiven Episode seines Lebens. Die nächste, umfangreichere Therapie bei der gleichen Kinder- und Jugendtherapeutin folgte und Besserung trat erneut zügig ein. Sie sprachen über Gott und die Welt und Lukas lernte mit letzterer besser umzugehen, ein bisschen Selbstverwirklichung stand auf dem Programm. Während die Jungs aus der Stufe ihr erstes Geld als Zivi verdienten, arbeitete Lukas an einem normalen Leben. Damals hat er es dann engen Freunden erzählt. „Man kann nicht von jedem erwarten, dass er gleich gut mit so einer Sache umgehen kann. Nur ehrlich müssen die Reaktionen sein“, sagt Lukas und fügt hinzu, dass er mit Offenheit fast nie eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Erneute Normalität stand am Ende der Behandlung, begleitet von der Hoffnung, dass es doch nun endlich gut sein müsse.
Auf Abitur und Therapie folgte ein Studium und so verschlug es Lukas nach Jena.
Schnell hatte er ein Zimmer gefunden und erste Freundschaften geknüpft. Doch mit wachsendem Druck kam wieder eine innere Unruhe auf. Das erste Referat überstand er mit zittrigen Händen und auch durch die erste Klausur kam er mit Hängen und Würgen. Dann verfiel er in alte Muster. „Ich ging abends ins Bett und stand morgens wieder auf, um Joggen zu gehen, ohne in der Zwischenzeit geschlafen zu haben. Man bemerkt das langsame Abgleiten, ohne sich dagegen wehren zu können. Das schockiert und frustriert im gleichen Moment“, schildert Lukas den erneuten Zusammenbruch. Der Schlaflosigkeit folgte Panik. Ohne ausreichenden Schlaf, dachte Lukas, würden die Klausurvorbereitungen unmöglich werden. Er las Texte und mit dem Ende des letzten Satzes kam die Erkenntnis, dass er sich an nichts erinnern konnte. Keine Namen, keine Daten, keine Formeln. Das Kurzzeitgedächtnis hatte sich verabschiedet. Manches Mal fiel sogar das Sprechen schwer. Er wurde aggressiv und zog sich mehr und mehr zurück. Ein Teufelskreis, der ihn am Ende beim Amtsarzt ausspuckte. Er ließ sich für die meisten Klausuren krankschreiben, schrieb nur eine im ersten, wenige im zweiten Versuch und manche Leistungskontrolle erst zwei Jahre später. Dass sein Prüfungsamt nach einem eingereichten Attest mehr als kulant reagierte, Fristen verschob und Nachprüfungen ermöglichte, ihm sogar einen Sonderstudienplan anbot, war in dieser Zeit hilfreich. Trotzdem geriet er in Verzug, ohne dumm oder faul zu sein.
Dieses Mal holte sich Lukas eine Überweisung zum Psychiater. Die Gesprächstherapien hatte er satt, zu enttäuscht war er aufgrund des erneuten Ausbruchs. Drei Monate vergingen, in diesem Zustand eine unerträgliche Zeitspanne, bevor er endlich vorstellig werden konnte. „Beim Psychiater spielte die Vergangenheit, anders als in den Gesprächstherapien zuvor, keine Rolle. Es ging um Symptome und die passende Medikation. Der Ursprung wurde ausgeblendet. Wohl war mir bei dieser Herangehensweise nicht“, sagt Lukas über die Anfangszeit der Behandlung. Die Tabletten, die er nach einer Weile bekam, hauten ihn erst einmal um. Er war träge, schlief nur noch, der Unterleib schmerzte und an Sport war nicht zu denken, zu schnell war Lukas erschöpft. Eine unverzügliche Verbesserung des psychischen Zustandes, wie sie sich ein jeder Patient wünscht, blieb aus. Im Schneckentempo ging es voran. „Freundschaft ist in diesem Moment wichtig. Leute, die einfach nur zuhören können, gaben mir großen Halt“, sagt Lukas über die Unterstützung, die ihm zuteil wurde. Und so ging es wieder einmal bergauf. Sogar ein Date, eine Verabredung folgte. Ein großes Ereignis, wenn man bedenkt, dass Lukas‘ letzte Beziehung zu diesem Zeitpunkt schon fünf Jahre zurücklag.
Und dann kam die Psychiatrie, der Tiefpunkt in Lukas‘ Erzählung. Es war Sommer und er hatte Semesterferien. Eine Zeit, in der er immer zu kämpfen hat, da ihm die wohltuende Regelmäßigkeit des Semesters abhanden kommt. Die Todesangst war wieder da und mit ihr bekannte Symptome wie Schlafstörungen und ausbleibendes Hungergefühl. Der Psychiater weilte im Urlaub – mal wieder. Lukas suchte seine Vertretung auf, die jedoch für ihn keine Verantwortung übernehmen wollte.
Wenige Stunden später teilte sich Lukas auf der offenen Station der Psychiatrie gleich gegenüber der Philosophen-Mensa ein Zimmer mit Ralf, einem Mittdreißiger mit schweren depressiven Störungen. „In dem Moment war es mir scheißegal, dass man mich einwies. Man sollte mir nur helfen“, sagt Lukas heute über seinen Aufenthalt. Die Ärzte strichen das Gros seiner Medikamente, Psychotherapeuten sprachen mit ihm. Er bastelte Blumengestecke, machte Sportgymnastik am Morgen, warf ein paar Körbe im Innenhof und an guten Tagen quatschte er mit Ralf. Manchmal spielten sie sogar Schach oder Dame. Freunde kamen und besuchten ihn und Lukas ging, nicht ohne sich abzumelden, mit großen Mühen in die Innenstadt und war am Ende froh wieder auf Station zu sein, auch wenn es oft schwer war mit den anderen Patienten zu leben, war deren Zustand meistens doch nicht sehr erbauend. Hausarbeiten schrieb Lukas in diesen Semesterferien keine.
Der größte Gewinn des Aufenthalts war der Verlust des Psychiaters. Eine Verhaltenstherapie wurde ihm angeraten, die er auch zeitnah antreten konnte – zeitnah im Sinne von zweieinhalb Monaten später. Im Rahmen dieser Therapie verstand Lukas zum ersten Mal, was in ihm vorgeht, wenn diese lähmende Angst in ihm aufkommt. Dass sie nur ein Ersatz für andere Ängste ist, die Lukas nicht zulässt. Dass es immer einen Gedanken gibt, einen Auslöser, den man finden muss, um die Angst zu verstehen und sie nicht ins Irrationale gleiten zu lassen. Er lernte, seine Angst zu kontrollieren. „Wenn ich heute darüber nachdenke, dann mutet die Lösung fast zu einfach an“, sagt er im Rückblick mit unterschwelligem Frust und Wehmut: „Von Zeit zu Zeit denke ich schon darüber nach, was mich diese Krankheit gekostet hat. Mir wird dann ganz anders. Allein auf das Studium bezogen kann man sagen, dass ich die ersten zweieinhalb Jahre verpasst habe, wenn nicht mehr. Was ich da betrieben habe, kann man ja nicht studieren nennen. Ich habe irgendwie versucht, die Mindeststandards zu erfüllen – mehr nicht. Viele verpasste Chancen, deren Akzeptanz ich mir erkämpfen muss. Eigentlich bin ich immer nur am Kämpfen.“
*Name durch die Redaktion geändert
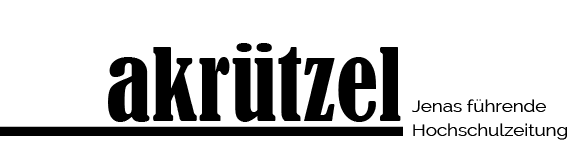
Meine Biografie sieht ähnlich aus, aber im endeffekt hilft einem niemand! Die Gesellschaft lässt einen im Stich. Unsere Leistungsgesellschaft ist nicht mehr menschengerecht.
Ich dachte bisher andere Ängste, Phobien und ähnliches sind Ersatz für die Todesangst, die man nicht zulassen will. So herum habe ich das noch nicht gehört. Interessant.