Die Geschichte Neulobedas
Von Christian Fleige
 |
| Foto: Katharina Schmidt 1964 erfolgte der erste Spatenstich für die spätere Trabantenstadt. |
„Am 1. Dezember 1967 erfolgte die Schlüsselübergabe. Einziehen durfte man jedoch noch nicht – nur einräumen“, erinnert sich Norbert Müller an seine persönliche Anfangszeit in der Theobald-Brenner-Straße in Neulobeda, ein Begriff, der sowohl Lobeda-West als auch -Ost umfasst. „Der Grund für die vorweihnachtlichen Verzögerungen war das kleine Kohleheizwerk in unserer Straße“, fügt Herr Müller hinzu. Es sei einfach noch nicht in Betrieb genommen worden. Dies passierte aber nur wenige Tage später und die Fernwärme füllte die neuen Wohnungen mit Gemütlichkeit. Die ersten Bewohner Neulobedas durften einziehen.
90 Mark Miete
Die Gründungsväter Neulobedas waren Carl Zeiss, Ernst Abbe und Otto Schott – zumindest indirekt. Sie machten Jena zu einer modernen Industriestadt, deren Name weltweit für Optik und enormes Wachstum stand. Und auch in der DDR war die Stadt mit dem Volkseigenen Betrieb (VEB) Carl Zeiss Jena von großer Bedeutung. Sie wurde zu einem industriellen Zentrum und Menschen kamen aus dem ganzen Land, um hier zu arbeiten oder eine Ausbildung zu beginnen. Neuer, moderner Wohnraum war vonnöten. „Zuvor wohnte ich zur Untermiete in verschiedenen Stadtteilen Jenas und in einer Zeiss-Baracke, wo man zu zehnt in einem Raum sehr unkomfortabel wohnte und schlief. Da waren die eigenen vier Wände für 90 Mark wirklich großartig“, räsoniert Herr Müller über seine Beweggründe, nach Neulobeda zu ziehen.
Doch die damalige Wohnungssuche war alles andere als einfach. Trotz der Mitgliedschaft in der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Zeiss (AWG Zeiss), getätigten Zahlungen und geleisteten Aufbaustunden mussten lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Herr Müller selbst wartete fast sieben Jahre, bis er seine Wohnung bekam. Hinzuziehende waren da klar im Vorteil, sie profitierten von den Wohnungsversprechen zu Werbezwecken, die auf der Suche nach Facharbeitern durch das Carl-Zeiss-Kombinat gemacht worden waren und eingelöst werden mussten.
Einmal eingezogen, galt es weitere Schwierigkeiten zu meistern. Neben der über eine Klappe kaum zu regulierenden Heizung, die einige Mieter mit Hilfe von Glasfasermatten doch bändigen konnten, war zu Beginn auch das unzureichend ausgebaute Straßen- und Wegenetz ein Problem. Dieter Ritter, der seit 1970 in der Werner-Seelenbinder-Straße wohnt, erinnert sich lachend an die Zeit: „Auf dem Schulweg gab es riesige Pfützen, die ein gewisses Eigenleben entwickelten. Auf der Suche nach dem verlorenen Turnbeutel meines Sohnes wurde ich einmal im Schlammwasser der Pfütze fündig – ich fand dort ein halbes Sportgeschäft. Außerdem machten sie den täglichen Gang zur Bushaltestelle oder das Fahren mit dem Rad zu einem sumpfigen Abenteuer.“ Die Busfahrt zum Arbeitsplatz sei zu den Stoßzeiten ebenfalls ein schwieriges Unterfangen gewesen, der Zustieg in die schon vollen Busse an manchen Tagen unmöglich.
Trotz der Unannehmlichkeiten wuchs Neulobeda stetig. 1969 wurde die erste Kaufhalle errichtet – ein Experimentalbau aus Gips. Eine wesentlich größere folgte nur ein Jahr später.
Nun kommt es auch zu einem Siedlungsfund auf dem Baugelände Lobeda-Ost. Entdeckt wurde die Wüstung Selzdorf aus dem Spätmittelalter. Mehr und mehr Schulen entstanden, die Kapazitäten reichten nicht aus. „Zur Eröffnung der Schule in der Nähe der alten ,Schmiede‘ in Block 11 gab es sieben erste Jahrgänge“, vergegenwärtigt sich Norbert Müller die kinderreiche Anfangszeit. Es sei sehr lebendig gewesen, kann Herr Ritter ergänzen, der selbst Vater zweier Jungs ist. „Kindergeschrei war den ganzen Tag in den Blocks zu hören, es verging erst in den Abendstunden. Die Kinder waren den ganzen Tag draußen, ohne dass wir sie einmal zu Gesicht bekamen.“
Mangelwirtschaft und Solidargemeinschaft
Lebhaft war darüber hinaus der Zusammenhalt der Bewohner, auch wenn Herr Ritter heute über den Begriff der „Sozialistischen Hausgemeinschaft“ nur noch schmunzeln kann: „Vielmehr waren wir eine große Solidargemeinschaft, die durch die Mangelwirtschaft geprägt war. Nicht nur unter den Genossen. Wir kannten alle 36 Familien im Haus und haben noch heute einen Altbestand an Erstbeziehern von 35 Prozent. Wenn der Trabbi mal kaputt war, wusste man, an wen man sich wenden muss. Jeder half jedem, es gab eine regelrechte Tauschwirtschaft – sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Regelmäßig, alle zwei Jahre, gab es ein großes Hausfest, die Hauspflege wurde auch gemeinsam erledigt.“ Ansonsten habe das Kulturelle in der Stadt oder im Kulturzentrum an der Karl-Marx-Allee gegenüber dem heutigen Kaufland stattgefunden.
Norbert Müller und Dieter Ritter sahen den Stadtteil Neulobeda mit den Jahren wachsen, auch über die Wende hinaus. „Natürlich gab es nach der Wende Leerstand – ganze Blöcke wurden abgerissen, die man heute gut gebrauchen könnte. Einige legten sich ein Eigenheim zu; heute kehren sie wegen der guten Infrastruktur zurück. Meine Frau und ich hatten nie das Verlangen zu gehen. Wir haben alles, was wir brauchen“, erklärt Norbert Müller die Tatsache, dass er nach 42 Jahren immer noch in Neulobeda wohnt. Und auch Herr Ritter zieht ein positives Fazit. Ihre Geschichten beleben die traurigen Fassaden und stellen sich dem Klischee der Trostlosigkeit in den Weg, das erst mit dem Fall der Mauer aufkam. Ihre Geschichten sind ein Treueschwur.
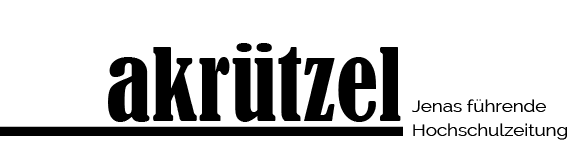
Die Wüstung in Lobeda/Ost ist Hirschdorf, nicht Selzdorf (das liegt oberhalb von (Alt-)Lobeda). Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Wüstungen_um_Jena#Hirschdorf
Ansonsten ein schöner Beitrag, danke.