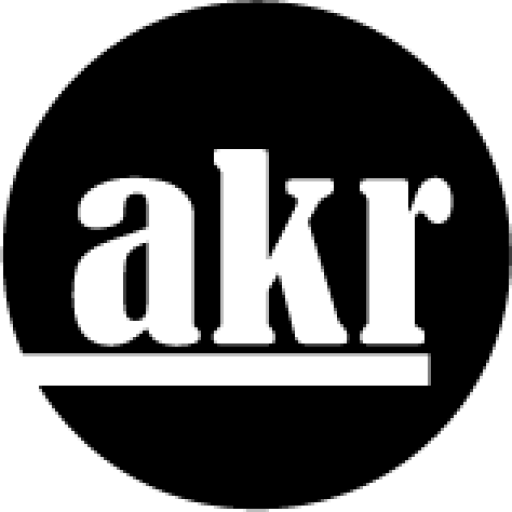Schillers “Don Carlos” am Nationaltheater in Weimar
Von Johannes Weiß
 |
| “Geben Sie Gedankenfreiheit!” Marquis Posa redet König Philipp ins Gewissen. Foto: David Graeter/DNT |
Nur selten kommt es vor, dass ein Programmheft so viel über eine Theatervorstellung aussagt. Während man sich sonst durch theoretische oder literarische Texte quälen muss, die mit dem Geschehen auf der Bühne sowieso nichts zu tun haben, ist es bei der Begleitbroschüre des neuen Weimarer „Don Carlos“ ganz anders: Abgesehen von der Besetzungsliste und einer Kurzzusammenfassung der Handlung sucht man hier vergebens nach Inhalten. Besser hätte die Inszenierung nicht beschrieben werden können. Gut, die Vorderseite des ausklappbaren Programmheftes zeigt zudem ein mit vielen bunten Pfeilen ausgestattetes DiaÂgramm, das einen Überblick über die im Stück vorkommenden Briefe samt Absender und Empfänger bietet. Auf der kompletten Rückseite hingegen darf man ein Poster vom Alten Museum in Berlin mit der installierten Leuchtschrift „all art has been contemporary“ bewundern. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Regisseur Felix Ensslin und die Dramaturgin Susanne Winnacker eben einfach wenig zu sagen hatten. Die über dreieinhalbstündige Vorstellung widerlegt dies nicht.
Wer schreibt wem?
Zugegeben, das Brief-Diagramm war vielleicht doch keine so schlechte Idee: In Schillers Drama vom spanischen Infanten Don Carlos ist nicht immer leicht zu durchschauen, wer wem was schreibt und bei wem es schließlich ankommt. Und auch nicht, wer was plant und wer was weiß. Das Weimarer Bühnenbild stellt einen Gegenpol zu diesem dunklen Intrigenspiel dar: ein zweigeteiltes Amphitheater, das sich bis aufs Skelett aus Metallstangen den Blicken der Zuschauer öffnet. Hier trifft Don Carlos (Paul Enke) auf seinen alten Freund Marquis Posa (Christian Ehrich), der ihn sogleich für den Freiheitskampf der von den Spaniern unterdrückten Flamen zu begeistern versucht. Der Kronprinz hat jedoch im Moment andere Probleme: Er liebt immer noch seine ehemalige Verlobte Elisabeth von Valois (Eve Kolb), die jedoch inzwischen zur Gattin seines Vaters geworden ist, des Königs Philipp II. (Markus Boysen).
Der taucht schon bald höchstpersönlich auf, mit schwarzem Mantel über weißem Anzug, schlechter Laune und einer markanten Stimme, die irgendwie an eine Mischung aus Arroganz und Alkohol erinnert. Auch wenn es nicht vieles an diesem Abend gibt, an das man noch längere Zeit denken wird – an Markus Boysens Verkörperung des einsamen Tyrannen wohl schon. Zerfressen von Misstrauen gegenüber seiner Frau und der gesamten höfischen Umgebung kriecht er blutverschmiert und mit zersausten Haaren auf der Bühne herum.
„Blut“ ist das passende Stichwort, denn wann immer dieses im Text vorkommt, lässt sich Regisseur Ensslin die Gelegenheit einer deutlichen – meist überdeutlichen – Veranschaulichung nicht entgehen. Im besten Fall kann er sogar eine Verbindung zu seinem anderen geliebten B-Wort herstellen und mit Hilfe des Siegellacks der Briefe die Hände der Beteiligten schön klischeehaft rot färben. Besonders tut sich der Herzog von Alba (Martin Andreas Greif) als Ritter mit der blutigen Faust hervor, der gegen Ende sogar einen ganzen Eimer voll roter Farbe über sich ausgießt.
Fahnenmarsch
Doch auch die weniger abgenutzten Ideen Ensslins sind nicht zwangsläufig aussagekräftiger. Ulrike Knobloch, die mit ihrer kleinen Rolle als Marquise von Mondecar offensichtlich nicht ausgelastet ist, darf im weiteren Stück Regieanweisungen zitieren, wehmütige Lieder singen, deklamierend im Kreis herumlaufen und bei der Erwähnung eines Volksaufruhrs mit roter Fahne auf die Bühne marschieren. Auf diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für geringfügig beschäftigte Schauspielerinnen hätte man zur Not auch verzichten können. Ebenso auf deplatzierte Zwischensequenzen, in denen unvermittelt Hintergrundmusik und Scheinwerfer voll aufgedreht werden.
Das wirkt genauso unfreiwillig komisch wie beispielsweise die Stelle, in der sich Carlos und Posa zur Seite wenden und gegen die Wand sprechen. Dass die Inszenierung schon allein aufgrund des offenen Bühnenbilds um Themen wie Öffentlichkeit und Vertraulichkeit kreist, hat der Zuschauer längst verstanden. Und doch kommen die Ideen des Regisseurs bei ihm nicht an, gerade wegen der übermäßigen Deutlichkeit, die oft ins Triviale und fast immer ins Wirkungslose abgleitet.
Zumindest versteht man am Ende nun doch ein bisschen besser, was die Rückseite des Programmheftes eigentlich aussagen soll: Wer Kunst von vorgestern sehen will, gehe statt in diesen „Don Carlos“ doch lieber gleich ins Alte Museum nach Berlin.