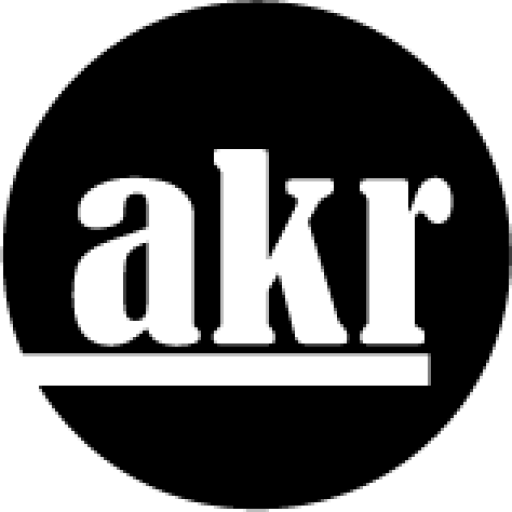Ein Gespräch darüber, wie man Gedanken verkauft
Das Gespräch führte Maria Hoffmann
 |
Gianfranco Walsh lehrt an der FSU Allgemeine BWL und ist auf Marketing spezialisiert. Dabei forscht er zum Verhalten von Konsumenten und Dienstleistungsmitarbeitern. Das Akrützel sprach mit ihm über Coolness, Kampagnen und süße kleine Hunde in Not. Foto: privat |
Welchen Stellenwert weisen Sie der Kommunikation im Marketing zu?
Das kommt von Unternehmen zu Unternahmen ganz darauf an. Grundsätzlich hat die Bedeutung der Kommunikation zugenommen. In den Medien gibt es eine unüberschaubare Zahl an Medienoutlets, wie Zeitschriften und Fernsehsender. Durch die daraus entstandene Konkurrenzsituation müssen Unternehmen heute viel mehr Geld ausgeben, um gehört zu werden. Das ist in den letzten Jahren ein ganz erhebliches Problem geworden.
Hat das auch etwas mit der Vielfalt zu tun, die uns heute begegnet?
Ja. Vielfalt an Wettbewerbern, die alle für sich Kommunikationspolitik betreiben. Über Kommunikation können sie versuchen sich abzuheben. Es sind dann nicht unbedingt faktische Unterschiede, sondern eher psychologische, die sie versuchen zu verdeutlichen.
Geht es dann mehr um die Persönlichkeit desjenigen, der das Produkt kaufen soll?
Ganz genau. Sie schreiben ihrem Produkt gewisse Attribute zu, wie: dieses Produkt macht Sie jünger, attraktiver, sportlicher; und das erreichen sie in der Regel nur über gute Kommunikation. Das Produkt selbst ist erst einmal was es ist. Es ist eine Jeans oder ein normaler Joghurt, und das, was sie über Kommunikation versuchen darüber hinaus noch an Nutzen darzustellen, ist häufig kaufentscheidend.
Würden Sie sagen, dass das Arbeiten mit Gefühlen heute stärker eine Rolle spielt?
Ich glaube das Arbeiten mit Gefühlen spielt eine stärkere Rolle, aber ich glaube auch, dass dieses plumpe Dem-Kunden-Angst-Machen heute relativ selten geworden ist. Der Trend geht eher dahin, zu überzeugen mit dem Nutzen des Produktes. Ein Produkt hat ja nicht immer nur einen qualitativen, funktionalen Nutzen, es hat auch einen preisbezogenen Nutzen. Dann spricht man noch vom sozialen Nutzen: Was tut das Produkt für mich im Hinblick auf meine soziale Zugehörigkeit? Und dann gibt es den emotionalen Nutzen. Also zu deutsch: Fühle ich mich besser durch das Produkt?
Wie ist das bei gemeinnützigen Organisationen, die eine Idee verkaufen?
Es gibt Kampagnen, die darauf abzielen ,problematisches Konsumverhalten zu minimieren. Man spricht da von persuasive advertising oder persuasive communication. Die ganzen sogenannten Sozialmarketingkampagnen basieren auf der Idee, dass man durch Überzeugung versuchen kann, zum Beispiel die Zahl der Suchtgefährdeten zu reduzieren. Die Non-Profit-Organisationen, die da dahinter stehen sind zum Beispiel staatliche Gesundheitsbehörden. Die verkaufen im Grunde die Idee eines gesunden Lebensstils oder einer nachhaltigen Umwelt. Das machen sie häufig mit ähnlichen Instrumenten wie die klassische Werbewirkung.
Doch Plakate, wie zum Beispiel von Antialkoholkampagen, setzen schon auf Angst, oder?
Ja, das ist allerdings nicht unumstritten. Aber ich denke da auch an Kampagnen wie „Gib Aids keine Chance“. Da ist mein Eindruck, dass weniger mit Angst gearbeitet wird, als vielmehr mit der Botschaft der gesellschaftlichen Akzeptanz. „Mach‘s mit“: Das befördert den Gedanken, dass es nicht mehr akzeptabel ist, ungeschützt Geschlechtsverkehr zu haben. Vor einigen Jahren gab es die größte Antirauchkampagne auf europäischer Ebene, die „Help – for a life without tobacco“-Kampagne. Dort hat man bewusst junge Fernsehkanäle gewählt, um die Spots zu zeigen. Die drei verschiedenen Spots zielten dabei alle auf die schwindende Akzeptanz für Raucher: Es ist nicht cool, die Leute mögen das nicht, nur Pfeifen und Spielverderber rauchen noch.
Was ist die Besonderheit bei Organisationen, die mit Ständen in den Straßen stehen und auf die Leute zugehen?
Das sind per Definition Dienstleistungsunternehmen. Zwar non-profit, aber Dienstleister. Die haben im Grunde kein Produkt, was sie zeigen können, sondern ein Versprechen. Aber da ist nichts, was Sie mit nach Hause nehmen und zeigen können, außer das gute Gewissen. Was diese Organisationen erreichen können, ist Aktivierung. Das heißt, dass sie sich mit einem Thema verstärkt gedanklich auseinandersetzen. Und das schaffen sie, indem sie informieren und exemplarisch Handlungsbedarf verdeutlichen. Aus gegebenem Anlass bekomme ich von Greenpeace regelmäßig die Mitgliederzeitschrift und dort wird immer ein Umweltproblem herausgepickt. Da können Sie eigentlich als normaler Mensch nicht still bleiben, ohne zu rufen: „Skandal!“. Oder Ärzte ohne Grenzen, die auf humanitäre Katastrophen hinweisen und wo sie tätig werden. Man sucht sich prominente Beispiele heraus, anhand derer man nachweisen kann, wie wichtig die eigene Aktivität ist.
Wie wichtig ist in dem Zusammenhang denn das direkte Gespräch, das diese Gruppen mit den Leuten eingehen?
Wiedererkennung ist natürlich extrem wichtig. Wenn ich so einen Stand organisieren müsste, würde ich bei Greenpeace nicht nur auf grün und weiß setzen, sondern ich würde vielleicht mit Plakaten arbeiten, die Aufmerksamkeit erregen und aktivieren. Es gibt gewisse Schemata in unseren Köpfen, auf die wir reagieren. Wenn wir zum Beispiel einen kleinen Hund in einer unwürdigen Situation sehen, dann erzeugt das Mitleid. Das sind auf jeden Fall emotional aktivierende Bilder. In der Straße würde ich dann mit Bildern arbeiten, die Aufmerksamkeit erzeugen, statt nur den Organisationsnamen hervorzuheben.
Ist es da eher nicht förderlich, wenn Spendensammler direkt auf die Menschen zugehen?
Könnte ich mir vorstellen. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht getestet. Im Hinblick auf die Antirauchkampagnen haben wir festgestellt: Wenn man die Leute dazu bekommt, nachzudenken und ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, hat man relativ gute Chancen, eine Verhaltensänderung zu initiieren. Das hieß in unserer Forschungsarbeit responsable thinking. Die Frage ist: Können sie dieses responsable thinking in der Innenstadt hervorrufen? Vielleicht durch Bilder kombiniert mit geeigneten Botschaften. Zum Beispiel eine Öllache mit dem Wort „Warum?“ darunter. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas funktioniert und die Leute auch anrührt.
Wäre das auch im religiösen Bereich denkbar?
Ich habe gerade das Buch „Das katholische Abenteuer“ von Matthias Matusek gelesen. Darin beschreibt er sehr schön, wie uncool es ist, in Deutschland über Religion zu sprechen. Es ist also ein Thema, mit dem man proaktiv gar nicht in ein Gespräch gehen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party oder in der Pause in der Mensa. Sie können über fast alles sprechen, aber mit Religion anzufangen, ich weiß nicht.
Würden Sie als Marketingexperte da einen Rat geben wollen?
Hätten sie mich vor einigen Jahren gefragt, hätte ich gesagt: Kirchenmarketing ist wichtig. Mittlerweile halte ich gar nichts mehr davon. Ich bin überzeugt, dass Religion erstens kein Produkt ist. Wenn Sie zweitens versuchen, über eine Veränderung der Form mehr Leute zu gewinnen, dann laufen Kirchen Gefahr, vielleicht an den zentralen Inhalten zu rütteln. Ich glaube, dann wären sie nicht gut beraten. Ein wichtigeres Thema ist da die Kundenbindung. Die zwei großen Kirchen haben Konfirmanden und Kommunionskinder. Über die haben sie noch Kontakt zu ihrer Zielgruppe. Unheimlich viele wandern ab und kommen nicht wieder.
Oft ist es elterlicher Wille, dass die Kinder zur Konfirmation gehen, und danach haben sie ihre Schuld erledigt. Die christliche Botschaft ist ja nicht die schlechteste. Dinge wie Nächstenliebe kann man auch als Solidarität bezeichnen, das sind ja keine aggressiven oder ausgrenzenden Konzepte. Das ist im Grunde mehrheitsfähig für eine funktionierende Gesellschaft. Nach ein, zwei Jahren müssten die Kirchen dann versuchen, aus den Kindern gebundene Kunden zu machen.