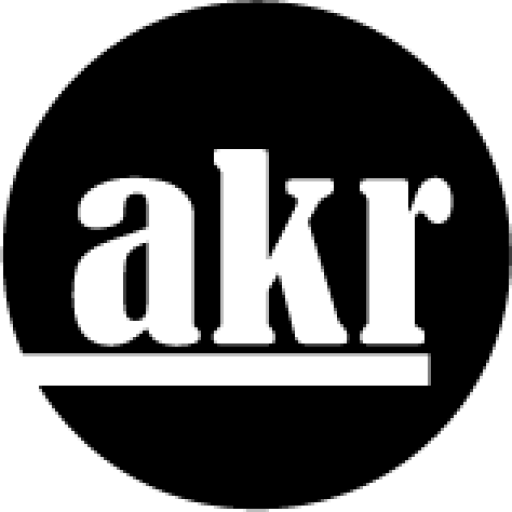Strauße sind nicht unbedingt das, was man unter einem schönen Tier versteht. Sie zu halten ist kompliziert, gefährlich und rentiert sich kaum. Wieso zum Teufel betreibt dann ein Ehepaar, das Inhaber eines Autohofs ist, nebenan zusätzlich eine Straußenfarm?
Von Christoph RennerBiegt man mit dem Auto in die Auffahrt zur Straußenfarm von Steffi und Andreas Schmidt ein, fragt man sich zuerst, wo hier bitte eine Straußenfarm sein soll. Rechts stehen liegengebliebene Autos ohne Kennzeichen nebeneinander und 100 Meter geradeaus stößt man auf eine stillgelegte Tankstelle. Ein Laster, vollbeladen mit Styropor, parkt unter dem Tankstellendach und davor lehnt ein kleines Schild an einer ehemaligen Zapfsäule. „Straußeneier hier“, steht darauf mit Edding geschrieben.
Im ehemaligen Tankstellenkiosk haben die Farmbesitzer ihr Büro. Wo sonst das Zigarettenregal steht, sind in einer Vitrine bunt verzierte Straußeneier ausgestellt. An der Glastür klebt mit Tesafilm befestigt ein Blatt; „Bin auf der Farm“, und darunter eine Handynummer. Steffi Schmidt ist nicht auf der Farm, sondern an ihrem Schreibtisch, auf dem sich Zettel und Dokumente zu großen Türmen stapeln. „Schmidt heiße ich, wie jeder“, so stellt sie sich vor. Doch nicht jeder hält sich 80 Strauße zusätzlich zu einem Autohof.
„Ich hab gerade keine Zeit, ich führe hier einen Autohandel“, sagt sie. Sie sei samstags immer allein für das Gewerbe und die Farm zuständig. „Wenn ihr euch die Farm ansehen wollt, dann geht einfach hinter die Werkstatt. Aber seid vorsichtig, die Strauße sind gerade in der Balz und die Männchen sehr aggressiv.“
In der Werkstatt schrauben gerade zwei Männer an einem orangenen VW New Beatle, oder was davon übrig ist. Neben der Werkstatteinfahrt stehen zwei ausgebaute Autositze auf Betonblöcken. Wer sich auf diese setzt, hat einen perfekten Blick auf eines der elf riesigen Straußgehege.
Die von Steffi Schmidt geforderten fünf Meter Abstand zum überraschend niedrigen Zaun hält man freiwillig. Selbst dem größten Tierfreund fällt es schwer, etwas Nettes über das Erscheinungsbild eines Straußes zu sagen. Besonders die balzenden Männchen wippen beim Gehen dümmlich mit dem Kopf und dem langen Hals, rhythmisch biegt sich die Gurgel dabei vor und zurück. „Walk like an Egyptian“ – nur auf hässlich. Hundeaugen sagen: „Ich mag dich“; Straußenaugen sagen: „Verpiss dich.“
Gegenüber der Farm, hinter der Werkstatt, gibt es einen riesigen Hof. Hier türmen sich Autoreifen, Schrott und verschiedene Autoteile. Ludolfs meet Straußenfarm.
„Jetzt habe ich doch noch kurz Zeit für Sie!“ Steffi Schmidt eilt über den Hof und die erste Frage an sie ist die, wie man auf die Idee kommt, in Droschka bei Trotz eine Straußenfarm aufzumachen.
„Der Mann“ habe so eine Privatfarm vor vielen Jahren mal in den Niederlanden gesehen, und danach immer von einer eigenen geträumt. Vor sechs Jahren hat sich dann endlich die Möglichkeit geboten. Ein Bekannter in Berlin hatte eine Straußenfarm, die sei ihm dann geschlossen worden, weil er die Auflagen nicht erfüllen konnte. Der Bekannte hätte dann die Strauße an den Berliner Zoo abgeben wollen, aber die hätten keine Verwendung für so viele Strauße auf einmal gehabt. „Also haben wir ihm die 14 Tiere abgekauft.“
Redet man mit Steffi Schmidt, dann stellt man fest: Es gibt verdammt viele Gründe, die dagegen sprechen, in Droschka bei Trotz Strauße zu halten.
„Da sollten erst Bisons rein.“
„Wenn man so ’ne Straußenfarm aufmacht, gibt’s viele Auflagen“: Strauße könne man nicht einfach so halten, sagt Schmidt. Die Vorschriften in Deutschland sind streng. Schmidt spricht von Auslauf und von Zaunhöhen, auch einen teuren Lehrgang hätten sie belegen müssen. Auf die Frage, warum der Zaun des einen Geheges so viel niedriger ist als der der anderen, antwortet sie: „Da sollten erst Bisons rein, aber da sind die Auflagen ja noch höher.“ Und da Strauße Zeit kosten, muss die Familie in ihrer Nähe leben. Die
Schmidts haben verdammt viel auf sich genommen, um immer bei ihren Straußen sein zu können.
Die Baufläche, auf der mittlerweile direkt neben den Straußengehegen das pavillonförmige, unfertige Haus der Schmidts steht, gehört wegen dem angrenzenden Autohof zum Gewerbegebiet – und darauf darf man eigentlich kein Wohnhaus bauen. Es kommt erschwerend hinzu, dass die Schmidt’sche Straußenfarm zu keinem Stadt- oder Wohngebiet gehört, sondern etliche hundert Meter vom Ortsrand von Droschka entfernt liegt.
„Zergliederung der Landschaft“ werde das offiziell genannt, wenn man hier bauen wolle, und es sei ja „immer ein Problem, wenn einer irgendwo hin bauen will, wenn das nicht Stadtgebiet ist“.
Nach vielen Streitigkeiten haben sich die Schmidts mit ihrem Bauvorhaben durchgesetzt, wovon das nicht verputzte Haus zeugt. Nun gibt es noch Probleme mit dem Abwasser. „Wir waren hier gar nicht an das Abwassernetz angeschlossen“, klagt Schmidt. Eine mehrere hundert Meter lange Leitung hätten sie extra nach Droschka legen müssen.
„Dann schlagen die Haken, die kannste ewig jagen.“
Der Hausbau gestaltet sich schwierig. Doch dass die Schmidts bald nicht mehr von Hermsdorf zur Farm fahren müssen, ist sicher besser, denn Strauße büchsen gern aus.
„Wenn oben auf dem Feldweg ein Quad vorbeifährt, dann starten die durch. Meistens rennt erst einer los, und die anderen haben gar nichts gehört, aber rennen einfach mit.“ Einen ziemlichen Herdentrieb hätten Strauße, und einmal in Rage, seien auch schon mal Zäune gebrochen. „Und wenn einer sich dabei die Beine bricht, dann ist es vorbei, dann kannste den notschlachten.“
Und wenn so ein Strauß einmal ausgebüchst ist, „dann schlagen die Haken, die kannste ewig jagen. Einmal ist einer über den Zaun und den Hausberg hoch. Wir sofort mit dem Kleintransporter hinterher, da musste hinterherfahren bis die matte werden.“ Wenn man den Strauß endlich zu fassen kriegt, muss man ihm eine Haube aufsetzen. „Dann wissen die nicht mehr, was los ist.“ Problem dabei: Der Strauß setzt sich einfach auf den Boden und steht nicht wieder von alleine auf. „Dann musste den Radlader holen und musst den da reinpacken.“
Während seine Frau erzählt, fährt ihr Mann Andreas in einem roten Kleintransporter vorbei. Ein Strauß verfolgt ihn am Gatter. Es sieht lustig aus, wenn Strauße rennen, außer sie rennen auf einen zu.
Steffi Schmidt erzählt auch von einem Vorfall, als sie aus dem Fenster ihres Büros geschaut und sie plötzlich ein ausgebrochener Strauß angeschaut habe. „Stell dir vor, so’n Ding läuft runter auf die Bundesstraße, was da für Unfälle passieren können.“
Schmidt zeigt auf die Zaunlatten und meint: „Da unten könnten sie durchkriechen, durch die Mitte auch oder einfach durchrammeln.“
Abgesehen davon, dass Strauße irgendwie nicht zu einer Autowerkstatt passen, sind sie offensichtlich ziemlich gefährlich. Steffi Schmidt habe auch schon mal nach einem Straußenüberfall im Krankenhaus gelegen; „Wenn die mit ihrer Kralle austreten, dann ruppt dir das ganz schön die Haut auf.“
Zwischen den zwei größten Gehegen führt ein schmaler Weg hindurch. „Manchmal läufst du da lang, dann faucht dich am einen Zaunrand ein Strauß an.“ Wenn man dann zurückweiche, erwarte einen schon das nächste Tier vom anderen Gehege.
Wegen solcher Gefahren hätten sie die Farm auch noch nicht wirklich publik gemacht. Wenn man eine Visitenkarte von der Straußenfarm in die Hand gedrückt bekommt, dann steht darauf „Silbertal Automobile.“
Wie verdient man an einer Straußenfarm?
Wenn man keinen Eintritt von Besuchern bekommt, wie kann man dann an den Straußen verdienen?
Das meiste verdiene man mit den Straußeneiern, ungünstig sei nur, dass zur Zeit, in der die Eier am gefragtesten sind, zu Ostern, die Strauße oft noch keine Eier legten.
„Eine Person kann sicher von der Farm leben, aber ansonsten stecken wir schon sehr viel Geld hier rein.“
Die „Entnahme“ der Eier sei ohnehin kompliziert. „Die legen ihr Nest ja irgendwo in die Mitte des Geheges.“ Dann müsse einer mit einer großen Eisenstange ins Gehege und das aggressive Männchen, von dem es in jedem Gehege nur eines gibt, ablenken. In dieser Zeit rennt dann eine andere Person mit einem Eimer zum Nest und packt schnell die Eier hinein. Ein Straußenei wiegt 1,5 Kilo, ein Hühnerei vielleicht siebzig Gramm. Dafür muss man für Hühnereier nicht um sein Leben rennen.
Mit der Fleischproduktion sei es auch schwierig: So ein Strauß wiegt ungefähr 130 Kilo, davon sind 100 Bein und Knochen. Das Fleisch von Keule und Hinterseite sei zwar sehr gefragt, aber eben auch anteilsmäßig sehr wenig. Außerdem muss man die Strauße, deren Weibchen zumindest fast so alt wie Menschen werden, spätestens im Alter von zwei Jahren schlachten. „Sonst werden die zu zäh.“ Dann könne man das Fleisch nur noch zu Wurst verarbeiten. Da der Fettanteil im Straußenfleisch aber zu gering sei, müsse man die Wurst dann mit Schweine- und Rindfleisch mischen.
Kommerzielle Schlachtung käme für die Schmidts aber ohnehin nicht infrage – die Auflagen. Schlachten darf man nämlich nur in einem eigens dafür vorgesehenen Schlachthaus und mit einer weiteren teuren Ausbildung.
Steffi Schmidt freut sich darauf, wenn ihr Haus endlich fertig ist. Und sie hofft, dass nicht eines Tages der nächste Kontrolleur kommt und ihr die Farm zu macht. Jetzt müsse sie aber los: Die Werkstatt wartet. „Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch unsere Lamas anschauen.“
Warum die Schmidts sich die ganzen Anstrengungen für ihre Strauße antun, muss an ihrer Begeisterung für die Tiere liegen. „Uns liegt schon viel an den Straußen, sonst würden wir sie ja nicht züchten“, ist Steffi Schmidts schlichte Antwort, als gäbe es nichts zu erklären. Man muss die Schmidts nicht verstehen, aber mit ihrem schrulligen wie sympathischen Hobby lassen sie die Ludolfs wie die größten Spießer dastehen.
Foto: Juliane Helm