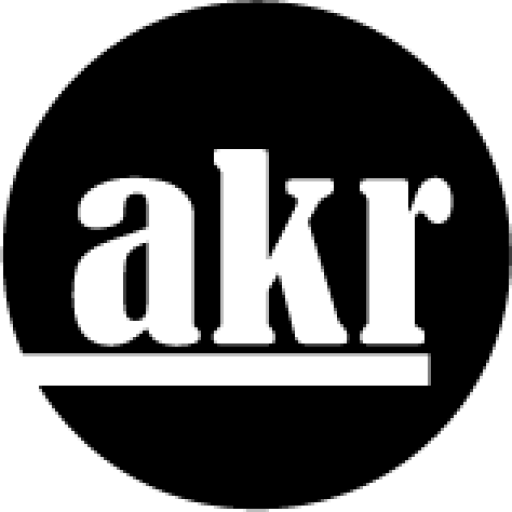INTJ, ESFP – so beantwortet der Test 16personalities die Frage nach dem Ich. Dabei verrät der Test mehr darüber, was wir uns wünschen, als wer wir eigentlich sind.
Text von Lorenz Neumann
Foto von Tim Baumberg
Kaum ein Persönlichkeitstest hat in den vergangenen Jahren einen größeren Hype ausgelöst als 16personalities.com. Zehn Minuten sollen reichen, um eine “wahnsinnig treffende” Beschreibung dessen zu erhalten, wer man wirklich ist. Über 1,5 Milliarden Mal wurde der Test bereits gemacht, über 22 Millionen Mal allein in Deutschland. Die Sehnsucht nach schneller Selbsterkenntnis ist groß. Nur bietet der Test weniger Einsicht als Inszenierung – er gibt sich tiefgründig, ist aber vor allem verkappte Selbstdarstellung.
Widerlegt und dennoch beliebt
Der Persönlichkeitstest selbst ist schnell erklärt. Er baut auf dem Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) aus den 1940er-Jahren auf. Menschen werden anhand vier vermeintlicher Gegensätze eingeordnet: extravertiert oder introvertiert, intuitiv oder beobachtend, denkend oder fühlend, planend oder wahrnehmend. Aus ihren Kombinationen entstehen 16 Persönlichkeitstypen. So wird man etwa als INTJ („Architekt:in”) eingeordnet: strategisch, planvoll und visionär. Andere wiederum enden als ESFP („Entertainer:in”), spontan, begeistert und immer mitten im Geschehen. Im Anschluss an den Test erhalten Nutzer:innen Beschreibungen zu angeblichen Stärken, Schwächen oder Karrierewegen – grafisch ansprechend, leicht verständlich und mit dem Anschein wissenschaftlicher Präzision.
Doch so überzeugend das zunächst klingt, empirisch ist davon wenig haltbar. Persönlichkeit besteht nicht aus Gegensätzen, sondern aus abgestuften Dimensionen, auf denen sich Menschen kontinuierlich einordnen lassen – das zeigen seit Jahrzehnten nahezu alle Studien, die etwa im Big-Five-Modell münden. Die Kategorien des MBTI überzeichnen diese Unterschiede und vermitteln eine Klarheit, die empirisch nicht gegeben ist. Entsprechend gering ist auch ihr Wert für Prognosen über Verhalten oder Entscheidungen.
Die Einwände sind altbekannt und häufig diskutiert. Nur ändert es wenig daran, dass die Typenlogik fortbesteht. Das ist kein Widerspruch, sondern der Kern des Phänomens: Die 16-Typen-Logik ist nicht trotz ihrer Vereinfachungen beliebt, sondern gerade wegen ihnen.
Identität To-Go
Moderne wissenschaftliche Persönlichkeitsmodelle liefern zwar präzise Messungen, sagen im Alltag jedoch erstaunlich wenig aus. Die meisten Menschen liegen in den Facetten irgendwo zwischen den Extremen und damit eher im Durchschnitt.
Aus solchen Befunden lässt sich keine spannende Geschichte über das eigene Ich formen. Die MBTI-Typen hingegen liefern genau das: klare Rollen, feste Bilder, Identität in handlichem To-Go-Format. „Abenteurer“ erzählt eine Geschichte über einen Menschen; „leicht extravertiert“ erzählt gar nichts. Dass diese Einteilung künstlich ist, ist nebensächlich. Entscheidend ist, wie gut sie sich erzählen lässt, wie auch ein Blick in die sozialen Medien zeigt: Auf Instagram und TikTok kursieren unzählige MBTI-Meme-Formate, viele schreiben die Buchstaben inzwischen sogar in ihre Social-Media-Bios. Kein Wunder: Die Typen passen ideal in unsere digitale Gesellschaft. Heute stellen wir uns so oft, so schnell und so öffentlich aus wie kaum zuvor. Zwischen Urlaubs-Selfies, Instastory-Highlights und Spotify Wrapped ist der Persönlichkeitstyp nur die nächste logische Ergänzung der Selbstinszenierungs-Spirale. Er lässt sich mühelos präsentieren, ist sofort verständlich und erfüllt den Wunsch, interessant zu wirken – und das gleich doppelt: für uns selbst und für alle, die zuschauen.
Der Preis der Klarheit
Die 16 Typen geben uns die Möglichkeit, in eine klug geschriebene Rolle zu schlüpfen, die wirkt, als wäre sie eigens für uns verfasst. Doch Bequemlichkeit hat einen Preis. Wer sich selbst und andere in Kategorien fängt, nimmt sich den Raum für Unsicherheit, Komplexität und Widerspruch – also genau jene Zonen, in denen echte Selbsterkenntnis entsteht. Und dort, wo die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich beginnen könnte, lädt der Test dazu ein, aufzuhören.
Ironisch ist, dass ausgerechnet der Wunsch, sich abzugrenzen und besonders zu wirken, am Ende erstaunliche Gleichförmigkeit hervorbringt. Acht Milliarden Menschen reduziert auf 16 Rollen – das ist kein Abbild der Vielfalt, sondern ein Kinofilm mit sehr kleinem Cast.
Wer sich wirklich verstehen will, kann keine Schablone nachzeichnen. Er muss sein eigenes Porträt malen.
Dieser Text erschien in der Ausgabe Nr. 453, November 2025