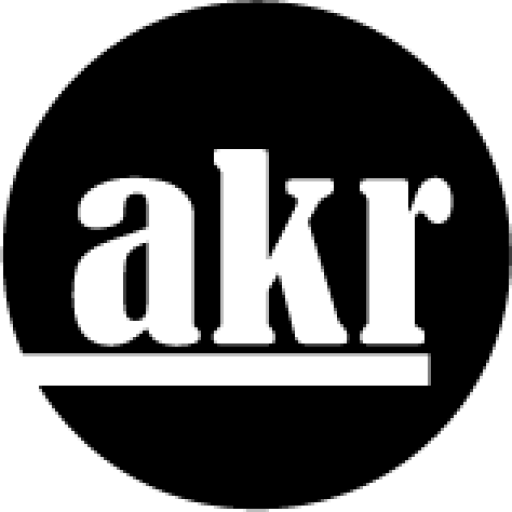Der Fortsetzungsroman blickt auf eine strahlende Kulturgeschichte zurück, die sich aber ihrem Ende zuneigt. Wir halten das Konzept künstlich am Leben und erzählen über die nächsten Ausgaben verteilt eine zusammenhängende Geschichte. Jedes Kapitel wird von jemand anderem verfasst. Hier sind alle Teile zu finden.
EINS

Lia kneift die Augen zusammen. Mama hat verboten, in die Sonne zu gucken. Lia wird blind, wenn sie in die Sonne guckt. Das sagt Mama immer. Aber vielleicht, wenn sie nur ganz kurz, vielleicht kann sie dann sehen, wer oder was sich hinter dem schrillen blinden Fleck verschanzt, den sie sich vom halben Hinschauen bisher nur so dürftig zusammengeahnt hat. Mama glaubt nicht daran, aber sie ist sicher, dass sie nur das richtige Verhältnis aus Gucktechnik und Zeit finden muss, um das Geheimnis zu lüften. Der Brunnen schießt seinen berüchtigten Wasserstrahl, wie immer ganz unerwartet. Die Kinder quietschen vergnügt. Ein Großer, der Lia unendlich alt vorkommt, schaut etwas gequält. Lia macht die Augen zu. In wohliger Gewissheit wartet sie eine Sekunde, bevor sich eine dünne Nieselmaske ganz sanft auf ihr Gesicht legt.
Heute sind viele Normale und Große beim Brunnen zu Besuch. Die meisten hat Lia noch nie gesehen, aber der Freund ist viel zu gefallsüchtig, um ein Geheimnis für sie zu behalten. Große und kleine, kurze und lange Fontänen, alles, was er ihr im Vertrauen gezeigt hat, wird jetzt vor den Fremden ausgespielt. Lia fühlt sich deshalb kurz verraten vom Brunnen. Sie und Mama sind oft hier, selbst wenn es dem Brunnen zu kalt zum Wasser speien ist. Sie wohnen nämlich ganz in der Nähe. In einem großen Haus in der Karl-Max-Allee 40. Mama hat Lia erzählt, dass Karl-Max ein Kommunist war. Wenn Lia fragt, was ein Kommunalist ist, seufzt Mama und sagt, dass Lia aufhören muss, dumme Fragen zu stellen.
Der Brunnen hat kleine Pfützen auf Lias Augenlider gelegt. Als sie und Mama am Sonntag in den Bergen waren, hat Mama ihr von wilden Blumen erzählt, aus denen die Vögel Morgentau trinken. Es ist schon Mittag und keine Vögel weit und breit, aber Lia möchte kein Risiko eingehen und wischt sich schnell alles vom Gesicht. Dann sieht sie, dass der Brunnen sie beobachtet und bekommt ein schlechtes Gewissen. Am Ende hat er ja doch nur sie und Mama. Da ist sich Lia sicher.
Dann verändert sich die ganze Welt, weil eine Wolke jetzt an der Sonne vorbei muss. Die Konturen von Häusern und Bäumen und Straßen und Leuten kommen kurz aus dem Licht zurück. Wie immer fühlt sich Lia ein bisschen erleichtert dabei und wie immer weiß sie nicht ganz genau, wieso eigentlich. Sie kann sich darüber aber auch keine Gedanken mehr machen, denn plötzlich ist da eine kleine Gestalt. Eine, die wie von der Sonne abgesetzt, auf einmal neben ihr steht. Lia schätzt sie auf einen halben Finger niedriger als sie selber. Sie vergisst manchmal, ob sie jemanden schon einmal getroffen hat. Vor allem bei den Großen passiert ihr das. Mama findet es peinlich, wenn Lia Bekannte nicht wiedererkennt. Als sie einmal Doktor Lackner nach seinem Namen gefragt hat, war Mama später sehr wütend und hat gesagt, dass Lia endlich lernen muss, sich Gesichter zu merken. Meistens denkt Lia nicht daran, wenn sie jemanden trifft. Dieses Mal aber schon. Sie sieht das andere Mädchen an und versucht sich zwei schief vom Kopf abstehende schwarze Zöpfe und ein Paar große Augen einzuprägen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie die Farbe von Apfelsaft oder dem Nesquik-Kaba haben, den sie jeden Morgen trinkt. Vielleicht stellt sich das Mädchen diese Frage ja auch. Lia würde ihr gerne sagen, dass beides schöne Farben sind. Überhaupt hat sie das Gefühl, eine große Anmut an dieser neuen Person zu sehen, die sie irritiert. Lia kann deshalb auch erstmal nichts tun, unter dem kabavergoldeten Blick. Sie schaut weg und zählt. Zwei, vier, zehn, zwölf Sekunden lang. Endlich hört sie eine leise Stimme etwas sagen. Die Worte gehen unter im spontanen Wasserrauschen. Ein verschluckter Anfang, der etwas löst und Lia reicht, um weiterzumachen. Sie ist jetzt ruhiger. Sie wartet geduldig, bis der Brunnen wieder schweigt. Sie erwidert mit ihrem festesten Blick und sagt: “Ich bin Lia und du?”.
ZWEI
„FF ist wieder an“, schreibt Ronja. „Bist du in L?“, antworte ich.
„Yees. Hast du Zeit?“ Ich wusste nicht, dass Ronja kommt und das mit der FF ist mir auch neu. Vor mir liegt der Laptop offen im Bett, daneben lose Zettel und Stifte, das Gewürzgurkenglas, Ladekabel und leere Flaschen auf meinem Nachttisch. „Später, ja“, antworte ich. „Um 6 so? An der FF?“ Fragt Ronja. „Passt :)“. Ich drehe das Handy um, lege es mit dem Bildschirm nach unten auf die Bettdecke, drücke Pause auf YouTube.
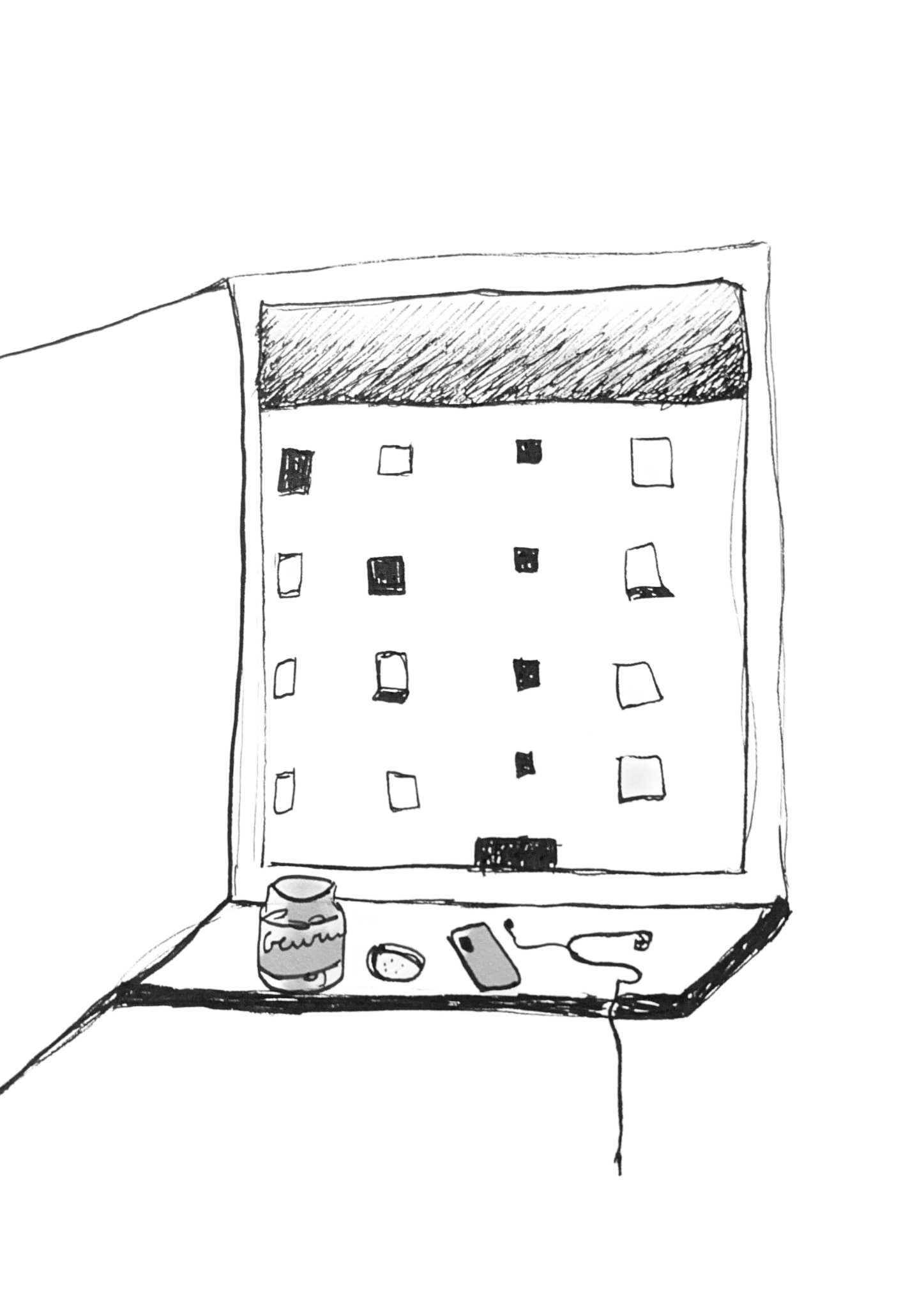
Ob Ronja mich damals am Brunnen wirklich gefragt hat, wie ich heiße, weiß ich nicht. Es ist aber auch nicht wichtig, weil vielleicht hat sie auch so etwas gefragt wie “Willst du von meinem Nutella to go?” oder “Warum starrst du so auf den Brunnen?” oder “Kommst du mit spielen?”. Irgendwas, auf das ich eben gut antworten konnte, eine Frage, eine Einladung, die ich sowieso nie ausgeschlagen hätte. Ronja hätte alles fragen können.
Heute sagt sie immer nur, dass da an dem Brunnen, an der FF, wie wir ihn jetzt nennen, die besten Jahre unserer Kindheit angefangen haben. Kein Wort darüber, dass sie mich angesprochen hat, was sie dazu bewegt hat, nix.
So genau interessiert es aber auch niemanden, wir gingen irgendwann in dieselbe Klasse und alle dachten, wir hätten uns in der Schule kennengelernt. Cool eigentlich, dass nur wir wissen, wie es wirklich war, dass wir uns schon seit dem Tag am Brunnen kennen. Und Mama natürlich, die weiß das auch noch.
FF steht für Fontainefläche, damit haben wir ein eigenes Wort für einen Ort, der allen gehört. Wenn sie wieder läuft, ist der Frost endgültig vorbei. Kein Glitzern mehr morgens auf den Autos und den Wiesen. Ich fische eine saure Gurke aus dem Glas. Es ist eine von oben, die knacken nicht richtig.
Die Wohnungstür geht auf und ich höre, wie der Schlüssel auf der Kommode im Flur abgelegt wird. Mama läuft in die Küche, schaltet das Licht an, macht den Kühlschrank auf. „Hallo-o“, ruft sie. Ich brülle ein Hallo zurück. „Steht Bolo auf dem Herd“, schiebe ich noch hinterher, bevor ich mich aufraffe und den Laptop auf den Schreibtisch stelle. Ich stöpsel das Ladekabel ein und schaue aus dem Fenster. Wir wohnen ganz oben, ich mag den Blick auf die Fassaden gegenüber. Vor allem nachts. Links oben im 7. OG ist das Licht immer am längsten an. Vier Stockwerke darunter ist es nie an. Die Stadt besteht aus Fassaden, den Schluchten zwischen ihnen und dem Leben darin. Wenn drinnen das Licht angeknipst wird, wenn die Sonne draufknallt und alles orangegold anstrahlt, wenn jemand eine Decke aus dem Fenster hängt oder aus dem Fenster raucht. Mein Blick wandert nach rechts unten, EG. Da raucht immer jemand aus dem Fenster. Meistens morgens ganz früh und abends. Ich versuche mich daran zu erinnern, wann das alles hier noch groß gewirkt hat. Irgendwann war alles nur noch normal. Normal, welchen Weg ich nehme, wo Ronja wohnt, wo die Bahn fährt, wo Arzt und Bäcker sind. Normal, dass die FF unser Treffpunkt ist, dass Mama mich nicht mehr überall abholt.
Im Flur schlüpfe ich in meine Shox und meine Jacke, linse um die Küchentür. Mama sitzt am Tisch und isst die aufgewärmte Bolo, scrollt am Handy, ihre Lesebrille auf der Nase, die Tasche auf dem Tisch abgestellt. „Bin draußen, bis später“ „Hallo erst mal!“ sie lächelt, „Danke fürs Kochen. Wohin geht’s denn?“ „Ronja ist da.“ „Ach schön, liebe Grüße. Ihr habt euch lange nicht gesehen, oder?“ „Joa schon“. Ich hab Ronja vor drei Wochen noch besucht, aber egal. „Bist du morgen arbeiten?“ frage ich noch. „Ja.“ Dann ist sie heute Abend zu Hause. Im Fahrstuhl friemel ich meine Kabelkopfhörer auseinander, schaue in den Spiegel und mir fällt ein, dass ich heute noch keine Zähne geputzt habe.
DREI

Wohin der Bus fährt, weiß ich nicht genau. Nur, wie viele Menschen schon in die Polstersitze geschwitzt haben müssen. Mich beschleicht der Gedanke, dass es eigentlich mein Körper ist, der stinkt. Heute Morgen schon Zähneputzen vergessen. Später hat unser Gespräch bei mir eine Spur Unbehagen hinterlassen, die sich dünn auf meine Haut gelegt hat. Unauffällig streife ich mit der Nase an meinem Shirt vorbei, rieche aber nur Zwiebeln von der Bolo, die ich für Mama gekocht habe und einen letzten Hauch von Ronjas Parfüm. Vielleicht hat Angstschweiß keinen Geruch.
Ronja hatte immerhin das mit den ungeputzten Zähnen nicht kommentiert. Bemerkt hatte sie es bestimmt, als wir uns unbeholfen vor dem FF umarmten. Sie roch nach Tender Blossom von Betty Barclay und trug ein Top, sodass ich die Gänsehaut auf ihren Armen rascheln hörte. Die Sonne schien fahl an diesem frühen Abend. Aprillicht, hatte ich gedacht und Ronja für ihren Ungehorsam bewundert. Drei Wochen lang hatten wir uns nicht gesehen. Vor drei Wochen, da war es abends noch dunkler gewesen und die Uhren hatten anders getickt.
Als ich kurz zuvor aus dem Treppenhaus ins Freie getreten war, hatte ich schon wieder nur gelbe Flecken gesehen. Jeden Tag schienen es nun mehr zu werden und ich begann mir Sorgen zu machen. Nach der steifen Umarmung ging ich gar nicht weiter auf Ronjas Frage nach meinem Befinden ein. Die Lage war ernst und um das zu unterstreichen, blickte ich Ronja wie ein sehr ernsthafter Mensch in die Augen.
„Jeden Tag sehe ich diesen Postboten, der in seinem gelben Postauto ganz laut MDR Klassik aufdreht. Das heißt, ich sehe das leere Auto, aus dem die Musik kommt, aber den Postboten sehe ich nicht“. So hatte ich es gesagt, ganz schnell und wie ich es mir abends im Bett vorgestellt hatte. Ein schöner Satz mit Nebensätzen und Kommas, wie wir es in Deutsch gelernt hatten. Ich war zufrieden, was das anging. Aber die Bedeutung hinter den Wörtern ließ mir keine Ruhe, seitdem ich angefangen hatte, über den Postboten nachzudenken. „Sobald man das tut, kann man nicht mehr aufhören. Was hat er für ein Leben? Wo ist er? Er hat seinen eigenen Kopf und seine eigenen Sorgen. Eigentlich haben alle ihren eigenen Kopf und ihre eigenen Sorgen. Und die Sonne geht jeden Morgen auf und auch wieder unter. Und dann gibt es noch all den Dreck, aber auch manchmal die Liebe und wo bleibe ich dann noch?“, hatte ich Ronja gefragt. Dabei flog ein winziges bisschen Spucke aus meinem Mund auf ihre Stirn. Kurz dachte ich, dass dieser Tropfen alles kaputt machen würde. Aber sie schien es zum Glück nicht zu merken, strich sich über die Arme und setzte sich auf die Betonblockbank, über die wir früher immer gehüpft waren.
„Also zu dem Postboten“ sagte sie und ließ ihren Blick über den Platz streifen, „keine Ahnung, gut für ihn, dass er seine Musik gefunden hat. Den Rest hab ich nicht so ganz verstanden. Du meinst doch immer, es ist so langweilig hier und zu normal und jetzt das? Vielleicht denkst du einfach zu viel nach“. Ich stand jetzt vor Ronja und starrte runter auf ihren Scheitel. Danach trat ich von einem Fuß auf den anderen und hoffte, sie würde noch mehr sagen. Aber sie blickte nur weiter umher und kratzte an ihren langen Beinen.
Nachdem ich eine Minute überlegt hatte, öffnete ich wieder meinen Mund: „Das geht nicht. Je mehr ich über das alles nachdenke, desto mehr Postboten tauchen auf. In jeder Straße sehe ich welche. Mit Fahrrädern oder zu Fuß. Aber niemals ist es der eine, der das Radio in seinem Auto laufen lässt. Und die Postboten erinnern mich an das Leben und das alles. Es fühlt sich an, als hätte sich ein Loch aufgetan, mitten vor unserem Haus und ich bin die Einzige, die es sieht. Warum machen die anderen nichts? Vielleicht wissen alle anderen, wer sie sind. Weil ihr Postbote im Auto sitzt mit Radio aus.“