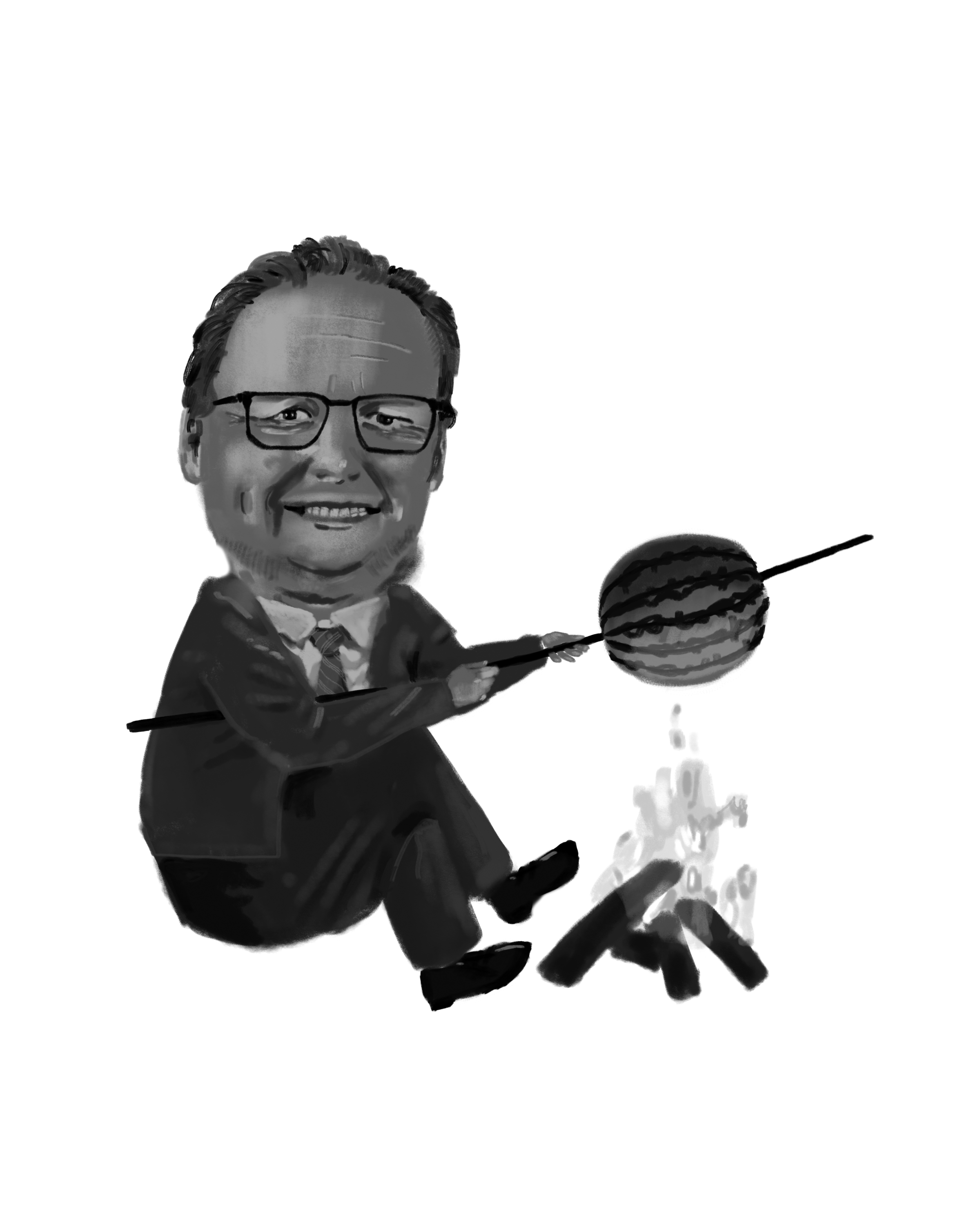Der Genozid in Gaza ist auch an der Uni Jena ein Thema. „Unsere Solidarität gilt allen Menschen“, schreibt das Präsidium. Gleichzeitig untersagt es pro-palästinensischen Stimmen an der Universität Veranstaltungsräume.
Text von Götz Wagner
Illustration von Yen
„Eindeutig Antisemitisch” titelte der MDR am 17. Juni: „Mitarbeiter der Uni sollen judenfeindliche Beiträge zugelassen haben”. Der Artikel spricht von einem Vortrag des Kinderarztes und Aktivisten Qassem Massri zur Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza ein paar Tage zuvor. Der sei zu Teilen antisemitisch gewesen, genauso wie Beiträge aus dem Publikum. Der Journalist zitiert den frisch ernannten Antisemitismusbeauftragten der Uni Thomas Kessler, Professor für Psychologie. Der israelischen Armee sei ein aggressiver Charakter unterstellt worden. „Die Hamas wurde dagegen als Befreiungsarmee gefeiert.” Kessler wäre bei wiederholten Nachfragen von der Menge ausgebuht worden und habe die Veranstaltung verlassen. Das Junge Forum (JuFo), die Jugendorganisation der Deutsch-Israelischen Gesellschaft fordert, dass sich die Organisator:innen distanzieren.
Mittlerweile hat der MDR den Artikel von der Website heruntergenommen. Denn wie sich herausstellt, ist die Darstellung entweder ungenau, falsch oder gefärbt. Was ist genau passiert?
Ein Mythos
Hendrik Süß, Professor für Algebra und Mitorganisator, hat den Vortrag mittlerweile auf Youtube hochgeladen. Er bezeichnet die Anschuldigungen als offensichtlich falsch.
Der Vortrag läuft ziemlich ruhig ab. Massri, der an der Helios Klinik Berlin arbeitet, spricht von seinem Arbeitseinsatz und Beobachtungen in Gaza 2024. In kurzen kalten Worten: Die Zerstörung des Gesundheitssystems durch die Bombardierung der israelischen Armee verschlechtert die Versorgungslage und dadurch sterben noch mehr Menschen als ohnehin schon. Er zeigt Bilder und Videos von Camps und Krankenhäusern.
Nach knapp einer Stunde meldet sich Kessler zu Wort. „Das ganze Desaster im Gazastreifen startete ja mit dem dramatischen Angriff vom siebten Oktober” – „Nein”, fällt ihm Massri ins Wort und bezeichnet diese Vorstellung als Mythos. Man könne die letzten Jahrzehnte der Vertreibung des palästinensischen Volkes nicht außer Acht lassen. „Das palästinensische Leid hat mit der Gründung des israelischen Staates auf palästinensischen Boden angefangen“. Das sei Geschichtsunterricht.
Kessler fragt ihn weiterhin, ob es den Menschen in Gaza ohne die Hamas nicht besser gehen würde. „Die Hamas ist als Konsequenz auf die israelische Besatzung anzusehen”, sagt Massri, egal wie man dazu stehe. „Ideologisch bin ich weit entfernt davon.”
“Ideologisch bin ich weit davon entfernt”
Qassem Massri, Aktivist und Kinderarzt
Unruhe gibt es, weil eine nicht zu identifizierende Person im Hintergrund darauf hinweist, dass jede Person eine Frage stellen darf, es solle jetzt die nächste von einer anderen Person gestellt werden.
Später fragt Kessler weiter: Ob nicht ein kritischer Umgang der Palästinenser:innen mit ihren schlechten Taten nötig sei, um die Situation zu verbessern. Massri entgegnet, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung nicht wahrnehme. Palästinenser:innen würden so zu sekundären Opfern des Holocausts.
Nun also zur Gretchenfrage des Jahres 2025: Ist das antisemitisch? Nun, das kommt auf die Antisemitismusdefinition an und welche politischen Interessen diese vertreten. Kessler und das Junge Forum folgen der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA. In einem Insta-Post kritisiert das JuFo Massris Aussage als rhetorisches Mittel, um Palästinenser:innen als Opfer des NS und Juden:Jüd:innen als Täter hinzustellen und gleichzeitig 6 Millionen Holocaust Tote zur Nebensache zu erklären.
Die Frage ist dann natürlich, ob Massri das, was ihm vorgeworfen wird, sagen wollte. Der Kontext legt das eigentlich nicht nahe. Von Juden:Jüdinnen spricht er nicht. Er versucht die historische Verantwortung Deutschlands auf Palästinenser:innen auszuweiten. Natürlich kann man auch unwillentlich antisemitisch sein, doch die Grenzen verschwimmen schnell.
Deshalb ist die Kritik an der IHRA international ziemlich groß. Das Problem: Ein konstruiertes einheitliches jüdisches Volk könne mit dem Staat Israel gleichgesetzt werden. So kann scharfe Kritik an Israel auch unberechtigt als Hass auf Juden:Jüdinnen dargestellt werden.
Eine andere Definition, die Jerusalem Declaration of Antisemitism, versucht dieses Problem zu lösen, scharfe Kritik am Staat Israel zu ermöglichen und diese als antisemitisch zurückzuweisen, wenn sie auf ein konstruiertes jüdisches Kollektiv gerichtet ist.
Wer welcher Definition folgt, ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch motiviert. Gruppen wie Jena for Palestine, die auch beim Vortrag anwesend waren, brauchen die JDA für ihren antikolonialen Kampf. Das JuFo die IHRA für den Zionismus. Andersherum könnte man sagen: Was antisemitisch ist, ist die Frage eines Streites, der geführt werden muss; am besten auch an der Uni unter Wissenschaftler:innen. Massris Vortrag kann man provokant, aber nicht flapsig als antisemitisch bezeichnen.
Die Vorgeschichte
Wer sich das Video für den buhenden, antisemitischen Mob anschaut, wird enttäuscht sein – er taucht bis zum Ende des Videos nicht auf. Es handelt sich um einen puren, ausgedachten Fakt. Kessler selbst sagt dem Akrützel, er könne sich nicht daran erinnern, sich so gegenüber dem MDR geäußert zu haben. Der Artikel wäre ihm nicht zur Freigabe geschickt worden. Er habe sich beim MDR gemeldet, woraufhin mehrere Punkte des Artikels abgeändert wurden.
Kommt diese Ausschmückung dann aus einer Journalist:innen-Feder? Der MDR ließ eine Anfrage zur Berichterstattung im Fall Massri unbeantwortet. Der Sender hat mittlerweile eine kurze Richtigstellung veröffentlicht.
Die Stellungnahme der Uni erwähnt die Berichterstattung des MDR gar nicht. Süß sieht die Uni in Verantwortung, ihn und die anderen Organisator:innen vor offensichtlichen Falschbeschuldigungen in Schutz zu nehmen. Grundsätzlich sei es nicht die Aufgabe der Uni, jeden Medienbericht zu kommentieren, so Pressesprecherin Katja Bär. Der Vortrag habe auch nicht in Uni-Räumlichkeiten stattgefunden.
Man hätte vor der Stellungnahme in einem Gespräch aller Beteiligten diskutieren können, bevor man einseitig Position bezieht, sagt Süß.
Diese Diskussion wird in der Senatssitzung am 24. Juni unschön nachgeholt. Und es stellt sich heraus: Die ganze Affäre hat ein Vorspiel. Nach dem Angriff und Mord der Hamas an über 1300 Israelis solidarisieren sich weltweit Institutionen, so auch die Uni Jena. Mit dem andauernden Sterben in Gaza entstand das Bedürfnis, sich auch mit den Menschen dort zu solidarisieren. Süß ist Erstunterzeichner und einer von über 300 anderen bekannten und unbekannten Uni-Persönlichkeiten und einigen Hochschulgruppen. Das Anerkennen israelischen Leids vom 7. Oktober dürfe nicht zu einer Blindheit gegenüber palästinensischem Leid führen. „Wir wünschen uns von unserer Universität, auch dieses Leid anzuerkennen und in einer neuen Stellungnahme in Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zu zeigen, dass der Wert des Lebens nicht mit zweierlei Maß gemessen wird.”
Wissenschaftsfreiheit
Die Uni lenkte ein und positionierte sich mit dem Schreiben: „Unsere Solidarität gilt allen Menschen.” Dieses betont die Komplexität der Situation und schwafelt von universellen Werten. Das Wort Gaza kommt genau ein einziges Mal vor, nämlich dort, wo die Uni erklärt, sie sei aufgefordert worden, eine Stellungnahme zu schreiben. Die Uni wollte keine unbestätigten Angaben übernehmen, so Bär. Man sei sich aber der humanitären Tragödie bewusst, ohne selbst politische Analysen vorwegzunehmen.
Nichtsdestotrotz, in der Stellungnahme sagt Uni-Präsident Andreas Marx: „Wir ermutigen unsere Wissenschaftler:innen, Studierenden und Mitarbeitenden, sich durch Forschung, Lehre und Diskussion mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu Versöhnung und Frieden beizutragen“.
Grundgesetztreu und ohne Antisemitismus – versteht sich. Diese Möglichkeit wurde in den letzten Monaten von vielen verschiedenen Akteur:innen genutzt, zum Beispiel in den Islam -und Politikwissenschaften oder auch der Theologie. Auch der Vortrag mit Massri ist nur ein kleiner Teil einer Vortragsreihe, in der auch deutliche andere Positionen zu Wort kommen sollten.
Ursprünglich hatten die Organisator:innen passenderweise einen Raum im Uniklinikum reserviert. Der Klinikumsvorstand genehmigte dies jedoch nicht, unter dem Verweis auf ihre Neutralität. Deshalb fragte Süß Anfang Juni einen Raum bei der Uni an. Das ist normalerweise eine bürokratische Angelegenheit der Raumvergabe. Die Kommunikationsabteilung der Uni informierte Süß dann aber, dass auch die Uni keinen Raum anbieten werde.
“Unsere Solidarität mit Israel ist unerschütterlich”
Andreas Marx, Präsident der Uni Jena
Es hätte die Befürchtung gegeben, dass die Veranstaltung politisch einseitig wirken könnte. Vom Hausrecht Gebrauch machen ist prinzipiell zulässig. Die Entscheidung kam also ganz von oben, von Präsident Marx persönlich und mit der gleichen Begründung – der „politischen Neutralität”, der die Universität verpflichtet sei. Das Präsidium habe aber bis zum heutigen Tag nicht konkretisiert, was man Qassem Massri persönlich vorwirft, so Süß.
Er versuchte, sich mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Gera gegen die Entscheidung zu wehren. Das Gericht lehnte den Antrag auf die einstweilige Verfügung jedoch erst mal ab. Die zuvor versprochenen Räume wurden beim ersten unliebsamen Redner wieder entzogen, noch bevor etwas passiert war.
Die Veranstaltung musste deshalb in die Räumlichkeiten der evangelischen Studierendengemeinde umziehen. Dies geschah über die Kontakte des Mitorganisators, Martin Leiner, Professor für systematische Theologie. Er hat viel zu Versöhnung im Nahen Osten geforscht und wird im Artikel des MDR als Hauptorganisator genannt. Laut eigener Aussage ist er aber nicht inhaltlich verantwortlich gewesen. Auch der Studierendengemeinde sei Druck gemacht worden, den Vortrag nicht stattfinden zu lassen.
Präsident Marx verteidigt das Vorgehen der Uni in der Stellungnahme: „Die Kritik des Antisemitismusbeauftragten der Universität Prof. Dr. Thomas Kessler, bestätigt noch einmal die Entscheidung der Universitätsleitung, der Veranstaltung keinen Raum zu geben und sich von der Veranstaltung zu distanzieren. Der Versuch, einen diskriminierungsfreien Austausch zu ermöglichen, sei gescheitert. „Die Universität fühlt sich daher bestätigt, auch künftig vergleichbare Veranstaltungen nicht in den Räumen der Universität zu genehmigen.“
Professor Süß sagt: „Kann die Reaktion auf potentielle Provokationen und problematische Äußerungen aus dem Publikum wirklich die sein, Veranstaltungen zu diesem Thema, die eine palästinensische Perspektive zeigen, nicht zuzulassen?“ Stelle man die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen erst einmal unter den Vorbehalt der Zustimmung des Präsidiums, sagt Süß, so habe man sich von der Wissenschaftsfreiheit im Grunde bereits verabschiedet.
Unerschütterliche Solidarität
Die Uni tut ein bisschen neutraler als sie ist. Im Universitätsmagazin Lichtgedanken wurde ein Interview mit Marx und dem Präsidenten der Technion-Universität Israel veröffentlicht. Die Unis verbindet seit 2020 ein Kooperationsvertrag und Marx war während seines Sabbaticals 2024 dort. Die akademische Welt ist eng geknüpft.
Im Interview sprechen die beiden Männer über gemeinsame Werte, die großen technischen Fortschritte, die Technion zu verantworten hat und tatsächlich darüber, wie heimkehrende Reservist:innen friedlich mit den Araber:innen am Campus vereint werden konnten. „In der Wissenschaft geht es um liberale Werte, um Inklusivität, um Gleichberechtigung, um Rede- und Meinungsfreiheit, um die Suche nach Wahrheit”, sagt Marx: „Das sind die Werte, die uns verbinden”.
Und wieder finden die abertausenden Opfer in Gaza keinen Platz. Das Gespräch habe sich auf die Rolle der Hochschulen und die akademische Freiheit konzentriert, sagt Bär. Andererseits wird der Hamas-Angriff explizit besprochen.
Die Präsidenten wünschen sich Frieden, das darf man ihnen sicher glauben. Marx sagt: „Für die Universität Jena ist klar: Unsere Solidarität mit Israel ist unerschütterlich, und wir werden auch in Zukunft unsere wissenschaftlichen Beziehungen zu israelischen Partnern stärken.”
Der Satz „unerschütterliche Solidarität” bei Schätzungen von bis zu mehreren hunderttausend Toten in Gaza ist schlecht gealtert. Natürlich beziehe sich diese akademische Solidarität aber nicht pauschal auf jede staatliche Maßnahme Israels. Und sie schaffe erst die Vertrauensbasis, um schwierige Themen anzusprechen, so Bär. “Die institutionelle Neutralität der Universität Jena bleibt davon unberührt.”
Im Interview bleibt trotzdem vieles unerwähnt: Die Technion arbeitet aktiv mit der Rüstungsindustrie zusammen, eine Zivilklausel wie an der Uni Jena gibt es nicht. Die Technion-Uni ist also in den Nahostkonflikt verstrickt.
Was man also sagen kann: Das Interview könnte als politisch einseitig verstanden werden. Das Wort Neutralität ist der Schutzschild der Uni, gegen ein Sperrfeuer politischer Ansprüche. Denn es ist zwar neutral vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine zu sprechen. Als noch Walter Rosenthal Präsident war, hieß es: “Die Invasion in die Ukraine bricht mit den Werten, die das Fundament der Aufklärung und der Wissenschaft bilden.”
Von der Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza darf jedoch nicht gesprochen werden oder zumindest nur, wie es der Uni-Leitung gefällt. Neutralität bedeutet dann jedoch nur, einem vorgeblichen gesellschaftlichen Konsens zuzustimmen. Kritisch wissenschaftlich ist das dann überhaupt nicht, das Wort stiefelleckerisch passt an dieser Stelle besser.
Es soll trotzdem weitere Veranstaltungen geben, die sich mit dem Thema Gaza beschäftigen, so Süß. Entweder man suche wieder Räume außerhalb der Universität auf oder aber man müsse sich selbst zensieren, um den Anforderungen der Uni-Leitung entgegenzukommen. Ob der Raum für den Vortrag rechtmäßig versagt wurde, ist noch ein Fall beim Verwaltungsgericht Gera. In Jena hat sich mal wieder verspätet auf eine kleine Art und Weise gezeigt, was überall sonst Trend war: Veranstaltungen zu Palästina werden gecancelt.
Nicht neutral
Katja Bär betont, dass das Verbot der Veranstaltung sich nicht gegen das Thema als solche wende. “Die Devise lautet: Komplexität zulassen, aber Extremismus keinen Raum geben.” Das habe in der Vergangenheit auch beim Nahostkonflikt geklappt, ohne dass aus Veranstaltungen Antisemitismusvorwürfe entstanden. “Jede:r darf seine Meinung äußern, doch niemand darf dabei Hass oder Falsches als Tatsachen verbreiten.” Was Extrem, Hass oder Falsches ist – darüber kann man sich mit der Uni-Leitung sicher streiten.
Thomas Kessler, der Antisemitismusbeauftragte, meint, man solle in Zukunft noch mehr darauf achten, dass Institutionen und nicht pauschal Bevölkerungsgruppen kritisiert werden und dokumentierte Fakten und die berechtigten Anliegen aller betroffenen Gemeinschaften im Fokus stehen. Momentan arbeitet er an einem Leitfaden, an dem sich die Diskussionen an der FSU orientieren sollen.
Eins kann man bei allem aber ganz sicher nicht sein – Nicht bei Antisemitismus überall auf der Welt und dem Genozid in Gaza – neutral.
Dieser Text erschien in der Ausgabe Nr. 451, Oktober 2025